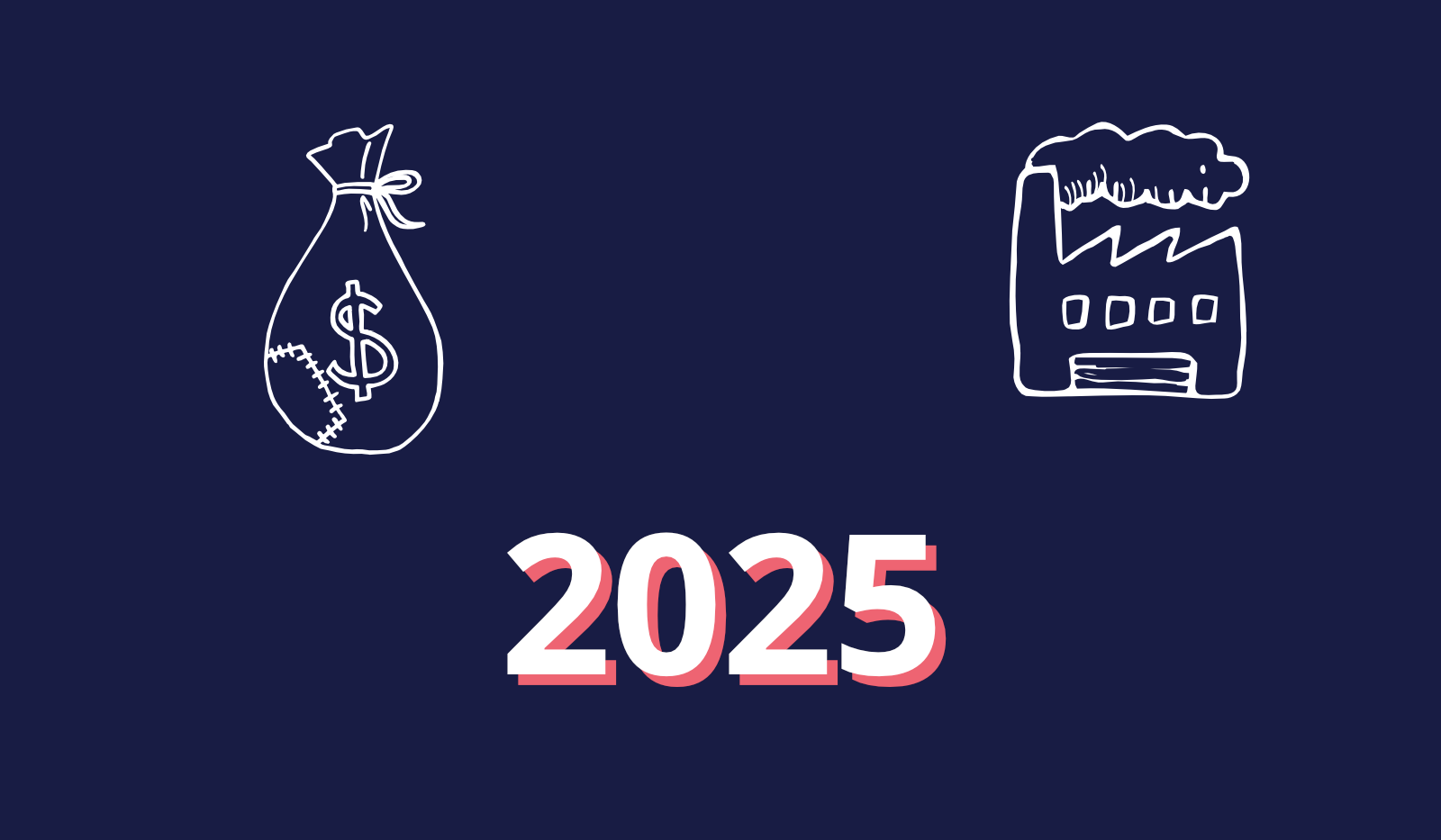Kaffee, Klima, Preise
Sara Schulte, Dr. Max Krahé
Die Kaffeepreise sind durch wetterbedingte Angebotsschocks stark gestiegen. Diese Schocks werden durch den Klimawandel wahrscheinlicher. Restriktive Zinspolitik kann solche Inflationsspitzen nur zu einem hohen Preis abfedern. Für langfristige Preisstabilität braucht es daher einen breiteren Rahmen zur Inflationsbekämpfung.
Die Klimakrise schreibt neue Preisdynamiken. Im Kaffeehandel lässt sich in Echtzeit verfolgen, wie extreme Wetterereignisse zu Inflation führen. Dabei veranschaulichen die verteuerten Kaffeebohnen ein grundlegendes Dilemma der Europäischen Zentralbank (EZB): Die klassische Geldpolitik hat keine geeigneten Werkzeuge, um kosteneffizient auf klimabedingte Angebotsschocks zu reagieren.
Teures Klima im Kaffeeanbau
Extremwetter treibt die Kaffeepreise aufwärts. Während sich die Gesamtinflation in Deutschland weiter um das Inflationsziel normalisiert, klettern die Preise für Kaffeebohnen aktuell in die entgegengesetzte Richtung (Abbildung 1). Heute liegen die Kaffeepreise um mehr als 20 Prozent über ihrem Vorjahresniveau.
Abbildung 1
Diese Preisentwicklungen gehen auf extreme Wetterbedingungen in den bedeutendsten Anbauländern zurück. Der Großteil der deutschen Kaffeeimporte kommt aus Brasilien und Vietnam.[1] Nach mehreren Jahren mit übermäßiger Trockenheit und Frostschäden erlebte Brasilien zuletzt die intensivste Dürre seit Beginn der Aufzeichnungen. Auch die vietnamesische Kaffeeproduktion ist durch extreme Hitze und anhaltende Dürre schwer beeinträchtigt.
Diese Ernteausfälle könnten nur Vorboten künftiger Schäden sein. Nicht nur werden Extremwetterereignisse bei fortschreitendem Klimawandel häufiger. Der Kaffeeanbau ist darüber hinaus grundsätzlich sensibel gegenüber Klimaveränderungen: Bereits ein globaler Temperaturanstieg von ein bis zwei Grad könnte die für die Kaffeeproduktion geeigneten Flächen bis 2050 weltweit halbieren.[2]
Die Preiseffekte dieser Angebotsverknappung sind bei Kaffee besonders groß. Denn während der Klimawandel die Produktionsbedingungen erschwert, wächst die weltweite Nachfrage. Über die letzten 20 Jahre ist der globale Kaffeekonsum im Durchschnitt um über zwei Prozent pro Jahr angestiegen.[3] Höhere Preise haben dabei auf die Nachfrage nur einen kleinen dämpfenden Effekt: Menschen trinken gerne Kaffee. Diese Kombination aus Angebotsschock und dennoch wachsender Nachfrage führt zu Knappheit. Das treibt die Preise.
Damit ist Kaffee ein Frühwarnsignal für die Preisfolgen des Klimawandels im Lebensmittelbereich allgemein. Wie der Dezernat Zukunft Supply Side Monitor zeigt, sind Produktions- und Importmengen für Lebensmittel in Deutschland stabil – trotz mehr als 30 Prozent höherer Preise in den letzten fünf Jahren. Die Nachfrage ist inelastisch, sie reagiert nur wenig auf den Preis. Essen müssen wir alle. Trifft eine inelastische Nachfrage auf Angebotsverknappung, weil durch Extremwetterereignisse Ernten ausfallen, sind teils drastische Preissteigerungen notwendig, um Nachfrage und Angebot wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Obwohl die Landwirtschaft nur grob vier Prozent des globalen BIPs ausmacht, könnte sie also zu einem signifikanten Inflationstreiber in den nächsten Jahren werden.
Ein verzögerter Steigflug
Seit Frühjahr 2025 entspannt sich die Lage wieder. Für Arabica-Bohnen und die günstigeren Robusta-Bohnen wurden Anfang 2025 die weltweiten Höchstpreise erreicht (Abbildung 2). Seitdem ist bei den Termingeschäfts-Preisen[4] ein merklicher Rückgang zu verzeichnen, unter anderem wegen Aussichten auf neue Ernten mit ausgeweiteten Produktionskapazitäten, auch wenn am aktuellen Rand hohe Volatilität herrscht.
Abbildung 2
Für Verbraucherpreise ist trotzdem keine Atempause zu erwarten. Dies liegt an den Marktstrukturen: Bis Warenpreisschocks vom Großhandel auf die Verbraucherpreise durchschlagen, dauert es in der Regel ein Jahr. Im deutschen Lebensmitteleinzelhandel setzen zum Beispiel üblicherweise Jahresgespräche zwischen Händlern und Herstellern den Preisrahmen. Deswegen wirken die Preisspitzen aktuell noch nach.
Selbst mit den üblichen Verzögerungen im Blick ist die Wahrscheinlichkeit einer mittelfristigen Entspannung aber gering. Bisher gab der Einzelhandel nur einen Teil der gestiegenen Einkaufspreise weiter: Während die Verbraucherpreise für Bohnenkaffee seit 2020 um circa 45 Prozent gestiegen sind, sind die Importpreise für ungeröstete Kaffeebohnen im selben Zeitraum um gut 150 Prozent gestiegen (Abbildung 3).
Abbildung 3
Der Wettbewerbsdruck im deutschen Kaffeeeinzelhandel kann es für Händler attraktiver machen, kleinere Gewinnmargen hinzunehmen und so die Verkaufspreise relativ niedrig zu halten, um keine Marktanteile zu verlieren. Bei Kostensteigerungen dieser Größenordnung ist aber zu erwarten, dass fallende Großhandelspreise zunächst genutzt werden, um vergangene Verluste wieder einzufangen.
Kostspielige Zinspolitik
Die sinkenden Kaffeegroßhandelspreise bringen höchstens vorläufig Entspannung. Mit der Klimakrise werden solche Angebotsschocks wahrscheinlicher; für den Kaffeeanbau und die gesamte landwirtschaftliche Produktion.
Mit konventioneller Geldpolitik lassen sich klimabedingte Inflationsschocks nur zu einem hohen Preis bekämpfen. Bei anziehenden Verbraucherpreisen sieht das geldpolitische Handbuch Zinserhöhungen vor. Dieser Zinshammer bremst die gesamtwirtschaftlichen Investitionen und den kreditfinanzierten Konsum, drosselt also die Nachfrage in der gesamten Wirtschaft.
Wenn Inflation durch eine gesamtwirtschaftliche Überhitzung getrieben ist, ist das ein passgenaues Werkzeug. Bei angebotsseitiger Inflation – etwa durch klimabedingte Missernten – ist aber das Gegenteil der Fall. Der Zinshammer wirkt breit, nicht gezielt. Er löst weder die konkreten Ursachen der Angebotsverknappung, noch drosselt er gezielt die Nachfrage dort, wo das Angebot zurückgegangen ist. Es ist ein bisschen so, als ob in einer Bäckerei einer von drei Öfen ausfällt, und das Management daraufhin den gesamten Betrieb – von Einkauf, Lagerung und Logistik bis zu Bäckerstube, Reinigung und Vertrieb – um ein Drittel drosselt und dabei auch die Anzahl der Mitarbeiter reduziert. Zwar wird damit die Inflation gebremst, doch die Kollateralschäden sind erheblich.
In einem Angebotsschock bleiben der EZB folglich nur schlechte Handlungsoptionen. Entweder sie unterkühlt die Gesamtwirtschaft durch restriktive Zinspolitik, oder sie entscheidet sich, die Preissteigerungen hinzunehmen.
Die erste Option kostet allgemeinen Wohlstand. Die zweite ist riskant – die EZB muss darauf hoffen, dass die Preissteigerungen von allein wieder abflachen – und birgt bei grundlegenden Gütern wie Lebensmitteln oder Energie soziale Sprengkraft.[5]
Für Preisstabilität müssen alle anpacken
Eine vorausschauende Preisstabilitätspolitik sollte deswegen versuchen, solche Zwickmühlen von Vornherein zu umschiffen.
Das bedeutet zum einen, dass die EZB langfristig denken sollte, um Zwickmühlen früh kommen zu sehen. Der analytische Rahmen der EZB sieht aber keine vertiefte Auseinandersetzung mit längerfristigen Preisstabilitätsrisiken vor. Damit ist eine systematische Kurzsichtigkeit in die Analysen der EZB eingeschrieben. Eine umfassendere Analyse struktureller Inflationsrisiken – zum Beispiel durch Klimafolgeschäden – ist Vorbedingung einer vorausschauenden Geldpolitik.
Bei vielen erkennbaren Zwickmühlen wird die EZB jedoch weder die Werkzeuge noch die Legitimation haben, um ihnen auszuweichen. Hätte die EZB zum Beispiel frühzeitig das Risiko einer Gaspreiskrise erkannt, wäre es ihr dennoch unmöglich gewesen, die absehbare Zwickmühle aus eigener Kraft zu umschiffen, weil sie den Schock nicht hätte verhindern können.
Zum anderen erfordert eine langfristige Preisstabilitätspolitik daher flankierende fiskal-, klima-, wettbewerbspolitische und möglicherweise noch andere Maßnahmen. Inflation ist kein einheitliches und historisch konstantes Phänomen, das stets durch exzessive Nachfrage verursacht wird. Preissteigerungen können vielfältige Ursachen haben. Wenn etwa klimabedingte Missernten Inflation verursachen, oder fossile Energieträger zunehmend teurer werden, kann sich Dekarbonisierung als langfristige Preisstabilitätspolitik herausstellen. Ein breit aufgespannter Rahmen zur Inflationsbekämpfung kann dazu beitragen, die ökonomischen Kollateralschäden durch restriktive Zinspolitik möglichst gering zu halten.
Unsere Leseempfehlungen:
- Zu Ostern hatten wir uns die Schokoladenpreise angeschaut. Auch hier spielt der Klimawandel eine Rolle. Noch wichtiger war jedoch, dass der Elfenbeinküste der Urwald ausgegangen ist. Dieser konnte in der Vergangenheit gerodet werden, um bei Bedarf die Anbaufläche auszuweiten. Nun, da diese Ressource erschöpft ist, steigen die Preise. Hier zum Nachhören in unserem Podcast „Die Geldfrage“.
- Die wichtigsten preisrelevanten Entwicklungen auf dem globalen Kaffeemarkt werden in diesem aktuellen Kurzbericht der Welternährungsorganisation (FAO) zusammengetragen.
- Einen guten Einstieg in die empirische Literatur zu Inflationseffekten von Extremwetterereignissen bieten Beirne et al. (2024). Sie unterscheiden zwischen verschiedenen Transmissionskanälen und heben die Bedeutung von negativen Angebotsschocks im Lebensmittelsektor hervor.
- Wer tiefer in die Herausforderungen einsteigen möchte, mit denen die EZB in Zukunft konfrontiert sein wird, wird bei Jens van ‘t Kloosters Papier „Overcoming myopia“ fündig. Er identifiziert die blinden Flecken der aktuellen geldpolitischen Strategie und zeigt, warum die EZB im Rahmen ihres Mandates weiter in die Zukunft schauen könnte und sollte.
Medienbericht 21.08.2025
Medienerwähnungen und Auftritte
- Rückblick
- Am 29.07.2025 war Philippa Sigl-Glöckner zu Gast im Podcast und sprach über die Einigung der EU mit den USA über die Zölle.
- Am 29.07.2025 interviewte The Pioneer Philippa Sigl-Glöckner zu den amerikanischen Zöllen und dessen Auswirkungen.
- Am 30.07.2025 zitierte der Tagesspiegel Background Niklas Illenseer zu Verschiebungen aus dem Kernetat in den Klima- und Transformationsfonds.
- Am 30.07.2025 schrieb der Tagesspiegel über den Haushaltsentwurf 2026 und zitierte Florian Schuster-Johnson dazu.
- Am 30.07.2025 zitierte die Bundestagszeitschrift „Das Parlament” Philippa Sigl-Glöckner zu den geplanten Investitionen des Sondervermögens.
- Am 31.07.2025 ordneten Niklas Illenseer und Florian Schuster-Johnson die geplanten Ausgaben im Klima- und Transformationsfond im Online-Magazin klimareporter ein.
- Am 31.07.2025 kürte das Forum New Economy den Fachtext „Nur 3% Spielraum“ von Florian Schuster-Johnson und Philippa Sigl-Glöckner zum Papier des Monats.
- Am 04.08.2025 zitierte das ZDFheute Philippa Sigl-Glöckner zu fehlenden Investitionen in frühkindliche Bildung im Haushaltsentwurf 2026.
- Am 12.08.2025 schrieb FLASH UP über die Zukunft der Rente und zitierte Florian Schuster-Johnson.
- Am 20.08.25 wurden in der Spiegel-Kolumne von Ursula Weidenfeld die Berechnungen des Dezernat Zukunft zur Manövriermasse im Bundeshaushalt erwähnt.
- Am 20.08.25 berichtete der Tagesspiegel Background über die Studie des Dezernat Zukunft „Der Sanierungskostendeckel“ mit Zitaten von Co-Autor Levi Henze.
- Am 21.08.25 war Philippa Sigl-Glöckner bei CNBC im Interview zu Gast und hat über die deutsche Wirtschafts- und Finanzpolitik gesprochen.
- Ausblick
- Am 03.09.25 von 10-12 Uhr veranstaltet das Zentrum für neue Sozialpolitik ein Webinar zu „Was brauchen Menschen für ein angemessenes Leben?“. Sie stellen dort die Ergebnisse unserer gemeinsamen Studie „Lebensqualitätsminimum“ vor. Hier geht es zur Anmeldung.
Fußnoten
[1] 2024 betrug der Anteil der beiden Länder an Deutschlands gesamten Kaffeebohnen-Importen rund 60% (United Nations International Trade Statistics).
[2] Genauer: Im RCP 2.6 Szenario, welches globale Erwärmung in Höhe von ein bis zwei Grad projiziert, würden die weltweiten Anbauflächen für Arabica-Bohnen um ca. 43 Prozent abnehmen, für Robusta-Bohnen um 51 Prozent. Im RCP 6.0 Szenario, welches eine Erwärmung von drei bis vier Grad projiziert, wären die Rückgänge 49 und 54 Prozent (Bunn et al. 2014, Onlineappendix, Tabelle S3).
[3] Zwischen 2004 und 2024 ist der globale Kaffeekonsum von 117 auf 167 Millionen 60kg-Säcke pro Jahr gestiegen. Das entspricht einem Gesamtwachstum von etwa 43 Prozent, also durchschnittlich etwa 2,1 Prozent pro Jahr (U.S. Department of Agriculture).
[4] Die globalen Preise für Kaffee – und eine Reihe anderer landwirtschaftlicher Erzeugnisse – bestimmen sich an Warenterminbörsen. Die dort gehandelten Termingeschäfte (oder Futures) sichern zu einem festgelegten zukünftigen Zeitpunkt und Preis den Verkauf einer definierten Menge Kaffeebohnen zu. Damit schreiben die Termingeschäfte die Großhandelspreise für Kaffee vor.
[5] Haushalte mit niedrigeren Einkommen geben einen prozentual größeren Teil ihres Einkommens für Nahrung aus und sind deswegen stärker von steigenden Preisen betroffen.
Der Geldbrief ist unser Newsletter zu aktuellen Fragen der Wirtschafts-, Fiskal- und Geldpolitik. Über Feedback und Anregungen freuen wir uns. Zusendung an sara.schulte[at]dezernatzukunft.org
Hat dir der Artikel gefallen?
Teile unsere Inhalte