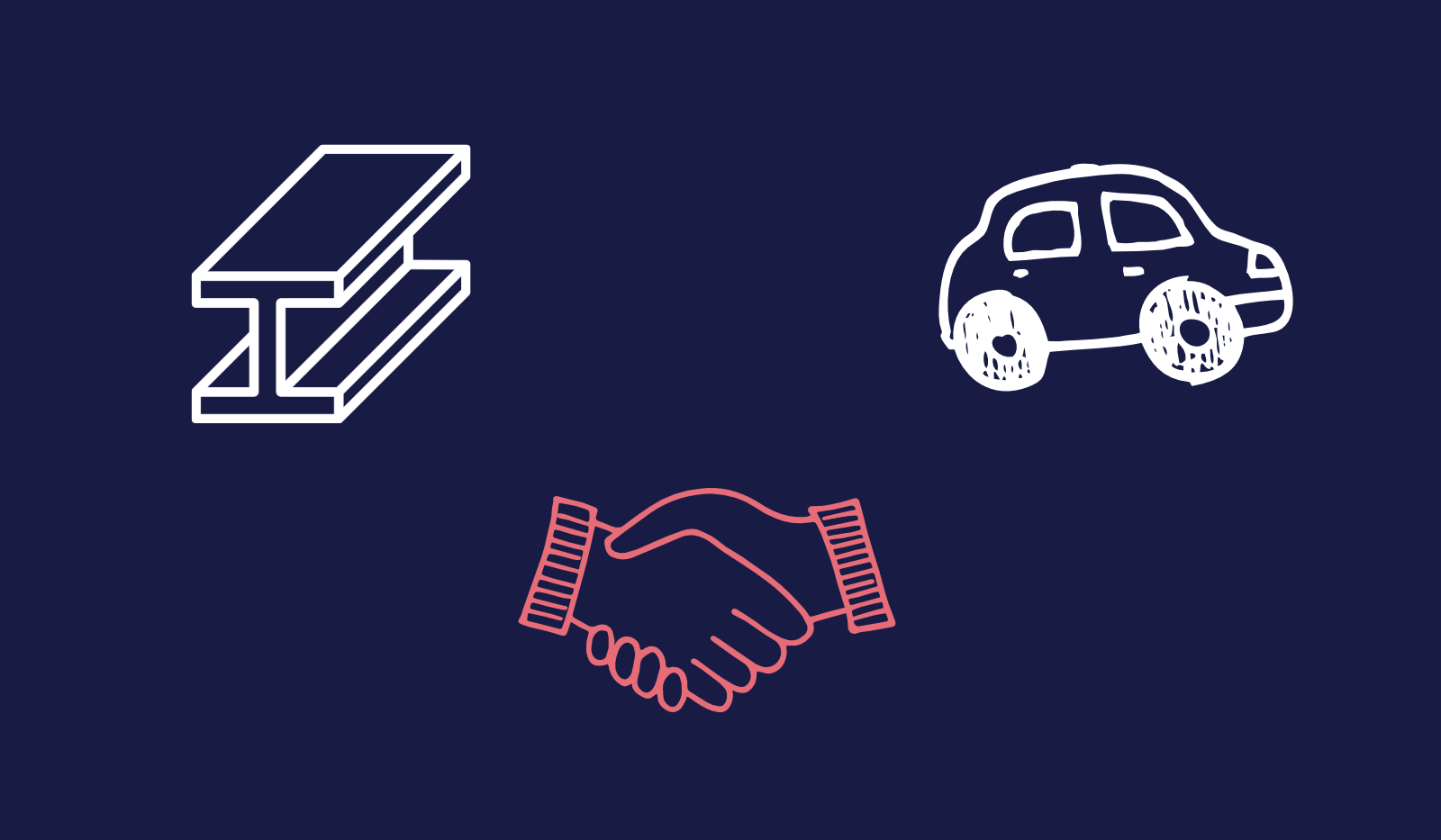
Sondergeldbrief: Tausche Strafzahlungen gegen grünen Stahl – Autodeal verfehlt sein Ziel
Dr. Maximilian Paleschke, Dr. Florian Schuster-Johnson
Auf dem heutigen Autogipfel wird diskutiert, wie die Industrie unterstützt werden kann. Neben Kaufprämien für E-Autos wird über ein Tauschgeschäft nachgedacht: Flottengrenzwerte lockern und Strafzahlungen erlassen, unter der Bedingung grünen Stahl zu nutzen. Der mögliche Erlass könnte deutlich größer ausfallen als die Zusatzkosten durch den grünen Stahl. Die strukturellen Probleme der Industrie löst das aber nicht, auch wenn Hersteller kurzfristig entlastet werden. Die Infrastruktur- und Innovationsprobleme bleiben ungelöst.
Wie ist die Situation?
Die deutsche Autoindustrie steckt in ihrer wohl tiefsten Strukturkrise. Die Produktion in Automobil, Maschinenbau und Metall geht dramatisch zurück (siehe Abbildungen 1 und 2): Von einst knapp 6 Millionen Autos werden heute nur noch knapp 4 Millionen in Deutschland produziert, ein Minus von 30 Prozent innerhalb weniger Jahre. Auch die angrenzenden Industrien entlang der Wertschöpfung, Maschinenbau und Metallproduktion, trifft es hart.
Abbildung 1
Abbildung 2
Grund dafür ist neben den anhaltend hohen Inputkosten vor allem der China-Schock 2.0. Chinesische Hersteller dominieren inzwischen den europäischen E-Automarkt mit preisgünstigen, gut ausgestatteten Modellen – und sie tun es mit massiver staatlicher Unterstützung, billiger Energie, lokal geförderter Batteriezellproduktion und optimierter vertikaler Integration. Deutsche Hersteller dagegen kämpfen mit technologischem Rückstand, hohen Kosten, fragmentierten Lieferketten, geopolitischen Spannungen, geringer inländischer Nachfrage und einem unklaren politischen Kurs.
Dass die Kosten in Deutschland wesentlich höher sind als in anderen Ländern (unter anderem China), ist nicht neu. Neu ist, dass in anderen Ländern technologisch bessere Autos gebaut werden als in Deutschland. Folglich haben deutsche Autobauer Schwierigkeiten, ihre hohen Preise durchzusetzen, mit denen sich die hohen Gehälter der deutschen Beschäftigten finanzieren ließen (mehr dazu gibt es in unserer neuen Podcastfolge mit Tobias Braun, CFO des Automobilzulieferers Benteler).
Zudem setzt China seine staatlich geförderten Überkapazitäten in der Automobilindustrie nun vermehrt im Ausland ab. Abbildung 3 zeigt, dass China mittlerweile Exportweltmeister ist. Damit fällt China als Kunde zunehmend für die deutsche Industrie weg. Außerdem machen chinesische Hersteller den europäischen Konkurrenten das Leben in anderen Ländern schwer. Dies liegt vor allem an einer breiteren Produktpalette, technologischer Innovation und kompetitiveren Preisen. Das Ergebnis: schwindende Marktanteile für deutsche Hersteller, sinkende Margen, Entlassungen. Die industrielle Basis, auf der Deutschlands Wohlstand jahrzehntelang ruhte, verliert deutlich schneller an Stabilität, als sich noch vor der Coronakrise abzeichnete.
Abbildung 3
Was wird diskutiert?
Beim heutigen Autogipfel geht es genau darum: Wie lässt sich die Wettbewerbsfähigkeit der Autoindustrie sichern, ohne die Klimaziele zu verpassen? Table.Briefings berichtete noch am Dienstag, die Regierung sei sich einig, dass es keine weiteren direkten Hilfen für die Branche geben soll. Dem widerspricht heute der Beschluss des Koalitionsausschusses, indem neue Kaufanreize für kleine und mittlere Einkommen für emissionsfreie Fahrzeuge geplant sind.
Die SPD will an den Klimazielen festhalten – null Emissionen bis 2035 – hat aber Flexibilität bei den Flottengrenzwerten signalisiert. CDU-Chef Merz und Wirtschaftsministerin Reiche drängen darauf, die CO₂-Ziele ab 2030 aufzuweichen und Verbrenner-nahe Technologien stärker zu berücksichtigen (z. B. Plug-in-Hybride oder Range Extender).
Ein zentrales Element der Diskussion könnte eine Art Deal sein: Autobauer könnten künftig von Strafzahlungen befreit werden, wenn sie europäischen oder grünen Stahl verwenden. Damit könnte ein Anreiz geschaffen werden, die heimische Stahlindustrie zu stützen und CO₂-Emissionen entlang der Lieferkette zu reduzieren – eine Art industriepolitisches Tauschgeschäft: kein direktes, neues Geld, aber ein regulatorischer Rabatt.
Wie wirken sich die drei Maßnahmen aus?
Auf den ersten Blick klingt der Plan “Strafzahlungserlass gegen Local-Buy-Verpflichtungen” nach einem Win-Win: weniger Strafzahlungen, mehr grüner Stahl, weniger CO₂.
Unsere Abschätzung zum monetären Effekt zeigt:
- Die drohenden CO₂-Strafzahlungen betragen laut Industrie bis zu 16 Milliarden Euro.
- Verteilt auf die rund 10,6 Millionen Neuwagen in der EU entspricht das rund 1.500 Euro pro Auto.
- Die Mehrkosten durch den Einsatz von europäischem oder europäisch-grünem Stahl liegen dagegen nur bei 20 bis 300 Euro pro Auto[1]
Netto-Effekt: Eine Kostenreduktion bzw. Margenerhöhung zwischen 1.200 und 1.500 Euro pro Fahrzeug. Die Berechnung nimmt an, dass die Hersteller die Strafzahlungen bereits eingepreist haben und diese komplett erlassen werden. Wahrscheinlicher scheint aber eine teilweise Stundung der Strafzahlungen bzw. ein Verschieben der Flottengrenzwerte.
Aber da die Größenordnung der Entlastung signifikant über den zusätzlichen Kosten durch eine EU-Stahl-Verpflichtung liegt, dürfte der Nettoeffekt positiv sein. Ob das Erlassen der Strafzahlungen zu Preisreduktion oder Margenerhöhung genutzt wird, ist schwer zu beantworten. Bei geringeren Preisen könnte eine erhöhte Nachfrage folgen, die je nach Ausgestaltung mehr oder weniger substanziell ausfallen könnten.
Genau hier könnte die im Koalitionsausschuss beschlossene „Förderung klimaneutraler Mobilität für niedrige Einkommen“ ansetzen, sollte sich diese vage Überschrift im Beschlusspapier als Kauf- oder Leasingprogramm entpuppen. Viel ist darüber noch nicht bekannt, lediglich, dass man drei Milliarden Euro dafür ausgeben möchte. Das ist nicht nichts, aber fast nichts, wenn man sich ansieht, welche Summen die deutsche Autoindustrie im Jahr umsetzt (z. B. VW mit über 300 Milliarden Euro in 2024). Die in Abbildung 1 gezeigte Lücke von 2 Millionen Fahrzeugen dürfte sich allein damit nicht schließen lassen, dennoch ist der Ansatz folgerichtig.
Des Weiteren könnte ein Nachfrageeffekt auf Seiten europäischer Stahlproduzenten erheblich sein. Im Extremfall, der vollständigen Umstellung auf grünen EU-Stahl, würde allein die deutsche Automobilindustrie eine zusätzliche Nachfrage von ca. 3 Millionen Tonnen pro Jahr erzeugen[2].
Es gäbe plötzlich einen großen Anreiz, die europäische Stahlproduktion auf grünen Stahl umzustellen. Außerdem wäre der CO2-Einspareffekt ebenfalls groß.
Die genannten Maßnahmen haben aber leider eines gemein: Die fundamentalen Probleme der Autoindustrie adressieren sie nicht. Mit Wettbewerbsfähigkeit und Transformation hat der Deal nur wenig zu tun. Jobs und Investitionen werden nicht primär von Strafzahlungen gefährdet, sondern unter anderem von technologischen Rückständen in Batterie- und Ladetechnologien, hohen Kosten und mangelnder Netzinfrastruktur (z. B. LKW-Ladesäulen).
Die Industrie würde entlastet, aber Anreize zur Investition in Zukunftstechnologien fehlen. Standortentscheidungen, Investitionsanreize und Preisstrukturen in der Elektromobilität werden durch Faktoren wie Fachkräfteverfügbarkeit, lokale Nachfrage, Förderpolitik oder Kosten der Lieferkette wesentlich stärker beeinflusst als durch moderate Preisnachlässe. Auch der Fokus auf „Übergangslösungen“ wie Range Extender und hybride Antriebe scheint inkonsistent, wo BYD gerade Fast-Charging in 5 Minuten vorgestellt hat.
Auch eine Pflicht deutsche Arbeitsplätze zu erhalten, hilft langfristig wenig: Wenn das Geschäftsmodell nicht profitabel ist, werden die Arbeitsplätze früher oder später in Gefahr sein – außer der Staat entscheidet sich zur Dauersubvention, was verteilungspolitisch schwer zu begründen ist.
Aus ökonomischer Sicht ist das Programm eine kurzfristige Industriebeihilfe – kein Instrument zur Hilfe bei der Transformation der Autoindustrie. Klimapolitisch kann der Deal “Strafzahlung-gegen-Stahl” Sinn ergeben, wenn er zu einer stark steigenden Nachfrage nach grünem Stahl führt. Da die Kosten von Stahl am Endprodukt vergleichsweise gering sind und durch den Erlass von Strafzahlungen kompensiert werden, können Autohersteller betriebswirtschaftlich wenig dagegen haben.
Die Frage ist jedoch: Wenn das Ziel die Stärkung der europäischen Stahltransformation ist, sollte der Staat dann nicht konsequenterweise direkt als Kunde die Nachfrage über die sowieso anstehenden Infrastrukturprojekte (z. B. Schienennetzausbau) erzeugen?
Zudem schwächt der Deal den Druck, die Flottenemissionen real zu senken. Bei gleichzeitigem Festhalten am Ziel 2035 wird der Anstieg an emissionsfreien Fahrzeugen in den kommenden Jahren umso steiler. Aufgeschoben ist schließlich nicht aufgehoben. Der Berg wird dadurch für die Hersteller nur schwerer zu erklimmen sein. Effektive Politik sollte versuchen, den Weg einfacher zu machen. Planungssicherheit schafft die parallele Diskussion um das Verbrenner-Aus 2035 jedenfalls nicht.
Was wären Alternativen?
Ohne flächendeckend verfügbare Ladepunkte – insbesondere entlang von Lkw-Korridoren und im ländlichen Raum – bleibt die E-Transformation unvollständig. Staatliche Förderprogramme sollten sich stärker auf Schnellladeinfrastruktur und Netzerweiterung fokussieren.
Als erfolgreich haben sich ebenfalls outputbasierte Unterstützungsprogramme wie z. B. IPCEI erwiesen. Durch Förderung im Halbleiterbereich wurden Cluster in Deutschland gestärkt und der Aufbau lokaler Produktionen gefördert. Die Bundesregierung könnte überlegen, wie sie diesen europäischen Ansatz in Deutschland stärker nutzen kann.
Des Weiteren könnten die Unternehmen über eine „Forschungszulage Auto“ bei der Entwicklung neuer Technologien und Diversifizierung in angrenzende Bereiche wie autonome Fahrservices oder Fast-Charger unterstützt werden. Die Notwendigkeit technologischer Exzellenz als „Schutzschild“ für Produktionsarbeitsplätze in Deutschland sollte klar werden und entsprechend sollte die technologische Vorreiterrolle deutscher Unternehmen unterstützt werden.
Zuletzt könnte der Industrie bei der Konsolidierung der Lieferketten geholfen werden. Dabei kann eine staatliche Beteiligung für notwendige Schlüsselrohstoffe (z. B. seltene Erden) sinnvoll sein. Direktbeteiligungen sind auch innerhalb des EU-Beihilferechts erlaubt und können in Schlüsselbereichen für Planungssicherheit sorgen, wodurch zusätzliches privates Kapital mobilisiert werden kann. Der Staat als “customer of last resort” kann in einigen Bereichen unkritisch sein, wenn, wie im Fall der seltenen Erden, die Kosten am Endprodukt gering sind. Beispielhaft sei hier die Beteiligung der US-Regierung an der Mountain Pass Mine genannt.
Es bleibt der Eindruck, dass die Maßnahmen den Herausforderungen der Industrie nicht gerecht werden. Während Kaufanreize zumindest die fehlende Nachfrage angehen und die Aufschiebung der Strafzahlungen kurzfristig hilft, Liquidität zu konservieren, fehlt der Diskussion um die Zukunft der Autoindustrie weiterhin die klare Richtung. Das erhöht die Unsicherheit in einer heute sowieso schon äußerst unsicheren Welt.
Unsere Leseempfehlungen:
- Um die Zukunft der deutschen Automobilindustrie geht es auch in unserer aktuellen Folge des Podcasts „Die Geldfrage“ (Spotify, Apple Podcast). Philippa hat den CFO von Benteler, Dr. Tobias Braun, zu Gast, der spannende Eindrücke aus der Praxis mitbringt. Unbedingt reinhören!
- Über den weltweiten Status der Automobilmärkte, speziell der E-Autos, berichtet die Financial Times in einem ausführlichen Artikel.
- Den Status der deutschen Produktion hat das Statistische Bundesamt diese Woche veröffentlicht, und die Helaba geht in ihrem Branchen-Report auf die Zahlen ein und setzt sie in Kontext.
Fußnoten
[1] Angenommen sind eine Stahlmenge von 700-900 kg pro Auto, ein low-carbon flat steel price premium von 150-300 Euro pro Tonne, bzw. ein EU-only price premium von 20-80 Euro pro Tonne. ICCT setzt ein Premium von 100-200 Euro pro Auto an.
[2] Unter der Annahme von 900 Kilogramm Stahl pro Auto und einem Output von rund 3,5 Millionen Autos pro Jahr bei derzeit geringem Anteil von grünem Stahl von ~0,1 Tonnen pro Jahr in der Autoproduktion.
Der Geldbrief ist unser Newsletter zu aktuellen Fragen der Wirtschafts-, Fiskal- und Geldpolitik. Über Feedback und Anregungen freuen wir uns. Zusendung an maximilian.paleschke[at]dezernatzukunft.org
Hat dir der Artikel gefallen?
Teile unsere Inhalte



