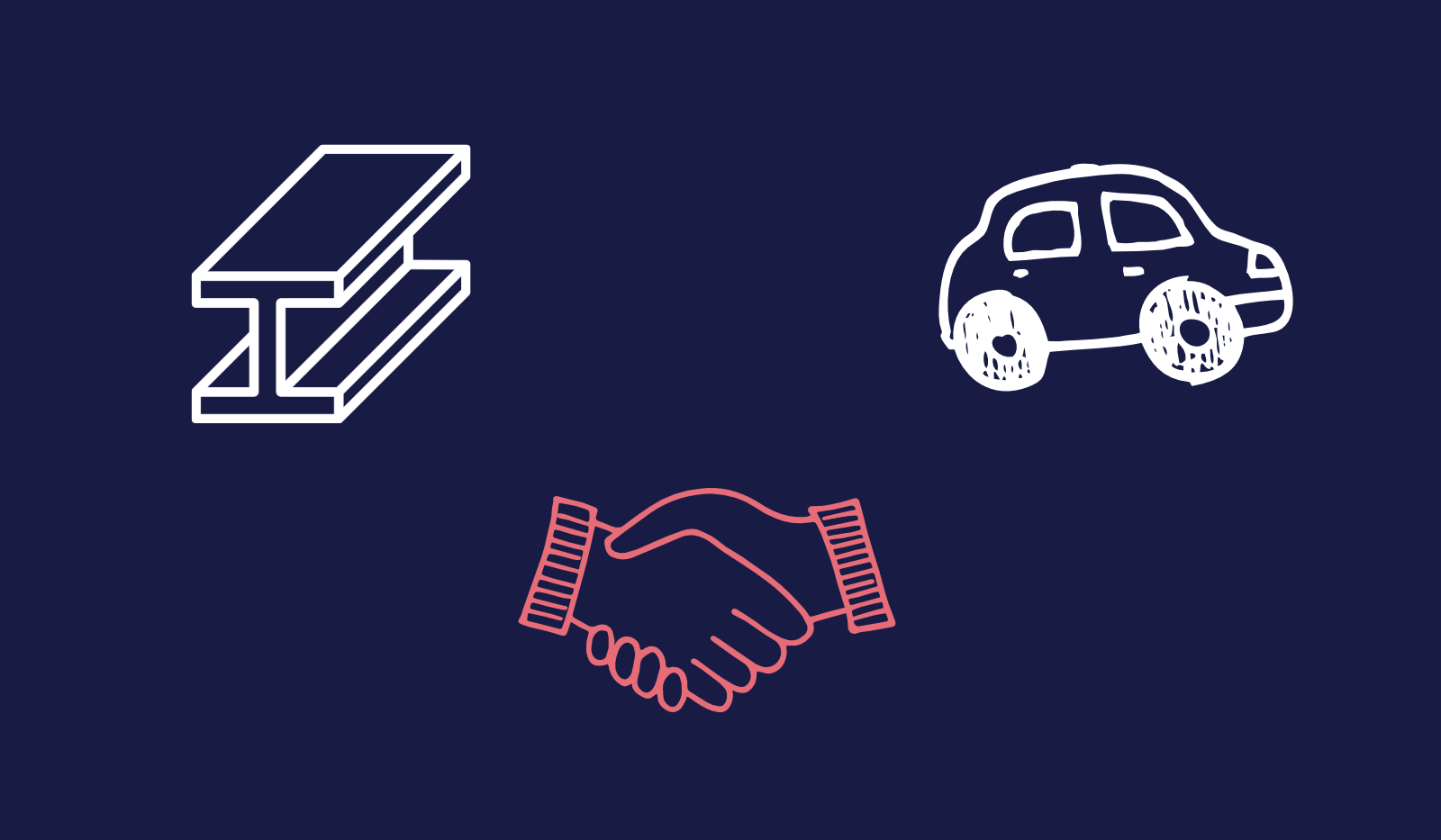Was bei der Heizungsförderung schief läuft
Levi Henze, Theresia Stahl
Schwarz-Rot möchte die Heizungs- und Sanierungsförderung (BEG) „fortsetzen“. Eine gute Nachricht. Doch die Ziele und Förderstruktur sollten überarbeitet werden. Der Gebäudesektor macht beim Klimaschutz nur zaghafte Fortschritte. Trotz Förderung sind die Kosten eines Heizungswechsels für viele zu groß, anderen schenken wir damit eine Vermögensaufwertung. Für eines der größten klimapolitischen Förderprogramme ist das nicht gut genug. In einem laufenden Projekt analysieren wir die Verteilungswirkung der Klimaneutralität im Gebäudesektor und machen einen Reformvorschlag.
Klimapolitisch kann der Gebäudesektor Kopfschmerzen verursachen. Die Emissionsminderungen der letzten Jahre waren gering und krisenbedingt. Das Gebäudeenergiegesetz der Ampel steht auf der Streichliste der neuen Koalition – mit unklarer Neuregelung. Und: Der bevorstehende europäische Emissionshandel für Gebäude und Verkehr könnte Preissprünge beim Heizen verursachen, die politisch schwer verkraftbar erscheinen.
Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Maßnahmen am Gebäudebestand sind teuer und vielfältige Eigentumsverhältnisse, die verschiedenen Dämmzustände sowie Finanzierungs- und Verhaltensfragen machen die Situation – vorsichtig ausgedrückt – ökonomisch unübersichtlich. Klimaneutralität im Gebäudebestand ist das größte Verteilungsproblem der Transformation.
Vom fossilen zum emissionsarmen Gebäudebestand: Ein vertracktes Verteilungsproblem
Was kostet der Weg hin zu einer klimaneutralen Heizung? Die Faktenlage ist unklar. In früheren Studien wurde vor allem auf die Verteilungswirkung der CO2-Bepreisung im Gebäudesektor geblickt. Da der Gebäudebestand in Deutschland wild durchmischt ist, führen Mehrkosten bei Brennstoffen auch innerhalb der Einkommensdezile zu einer breiten Streuung der Mehrbelastung.
Aber die CO2-Bepreisung ist nur ein Mittel zum Zweck der Vermeidung von Emissionen. Wir wollten die Kosten des eigentlichen Ziels – Klimaneutralität – besser verstehen. Deshalb erforschten wir die folgenden Fragen:
- Welche Verteilungswirkung hat die Transformation zu einem klimaneutralen Gebäudebestand?
- Lindert die bestehende BEG-Förderung das Verteilungsproblem?
Für die folgenden Berechnungen gehen wir von den besten verfügbaren Daten zu den Kosten von Sanierungs- und Heizungswechsel aus. Wir unterstellen langfristig plausible Strom- und Gaspreise ohne CO2-Bepreisung: Wir wollen ein Vorher (fossile Welt) und ein Nachher (klimaneutrale Welt) vergleichen. Der Umfang der Sanierungsmaßnahmen ist so gewählt, dass ein kosteneffizienter Wärmepumpen- und Wärmenetzbetrieb möglich ist.
In Kombination mit den Mikrodaten des Sozioökonomischen Panels haben wir die Verteilung der Mehrkosten mit und ohne Förderung abgeleitet.[1] Die detaillierten Annahmen werden wir in einer Folgepublikation diskutieren – sie sind für die folgende Diskussion zunächst unerheblich.
Abbildung 1
Abbildung 1 zeigt die Verteilung über die Einkommensdezile der jährlichen Mehr- oder Minderbelastung (durch Heizkosteneinsparung) in Boxplots.[2] Ohne Förderung (erstes Panel) ergeben sich starke Mehrbelastungen in den unteren Einkommensdezilen von bis zu 11 Prozent des Haushaltseinkommens.
Noch auffälliger ist die breite Streuung: Bis weit in die Mitte der Einkommensverteilung divergiert die Belastung – bzw. Ersparnis – von 4 bis minus 5 Prozent des Einkommens.
Das zweite Panel zeigt die Ergebnisse ohne Förderung in Mehrfamilienhäusern. Wir gehen von voller Kostenweitergabe an die Mieter:innen aus. Trotz dieser Annahme ist klimaneutrale Beheizung für die weit überwiegende Mehrheit der Haushalte eine Nettoersparnis.[3] Es bleibt die Frage, unter welchen Bedingungen Vermieter:innen entsprechende Maßnahmen auch wirklich durchführen.
Bei der Simulation der BEG-Förderung (Panel 3 und 4) berücksichtigen wir zielgenau alle Bestandteile der Fördersystematik je nach Haushaltstyp, inklusive des Einkommensbonus für Heizungsanlagen und des Bonus für Worst Performing Buildings.[4] Diese beiden Förderbestandteile sind maßgeblich dafür, dass die Belastung im geförderten Fall für praktisch alle Haushalte unter 2% des Haushaltseinkommens sinkt. Die Förderhöchstgrenzen bewirken zudem, dass Menschen mit hohem Einkommen (und eher großen Häusern und Wohnungen) nicht allzu stark „überfördert“ werden.
Für weit mehr als die Hälfte aller Haushalte wäre der Wechsel zum klimaneutralen Gebäude mit der bestehenden Förderung sogar wirtschaftlich. Teils ergäben sich substanzielle Einsparungen von 5 bis 10 Prozent des Haushaltseinkommens. Zur Erinnerung: Der absehbar steigende CO2-Preis ist hier bewusst nicht berücksichtigt.
Wie kommt es dann, dass der Gebäudesektor trotzdem im Schneckentempo Richtung Klimaneutralität kriecht?
It’s the money, stupid! Große Anfangsinvestitionen trotz Förderung
Die plausibelste Hypothese: Die hohen Anfangsinvestitionen, die Haushalte stemmen müssen. In Deutschland verfügen 30 Prozent der privaten Haushalte über weniger als 10.000 Euro an Vermögen. Die meisten Haushalte können nicht das notwendige Kapital aufbringen, um die eigenen vier Wände klimakompatibel zu machen (Abbildung 2): Ohne Förderung sind Investitionen von 80.000 bis 100.000 Euro in Ein- und Zweifamilienhäusern keine Seltenheit (Panel 1).
Die gegenwärtige Fördersystematik lindert das Problem: Sie senkt die maximalen Investitionsbedarfe pro Haushalt bis in die Mitte der Einkommensverteilung auf etwa 60.000 Euro (Panel 3).
Abbildung 2
In Mehrfamilienhäusern sind die Investitionsbedarfe pro Haushalt deutlich geringer (Panel 2 und 4). Doch ein beachtlicher Teil dieses Gebäudebestands gehört Privatpersonen. Diese müssen die Maßnahmen für das gesamte Gebäude finanzieren, anstatt nur für eine Wohnung.
Trotz Förderung sind diese Investitionssummen oft nicht finanzierbar. Die BEG-Förderung wird über Geschäftsbanken abgewickelt. Diese können – auf Basis ihrer eigenen Bonitätsbewertung – höhere Finanzierungskosten ansetzen oder den Kredit ganz verweigern.
Ist die Finanzierung mit eigenen Ersparnissen möglich, gibt es eine andere Herausforderung. Die Opportunitätskosten einer Eigenkapitalfinanzierung sind hoch. Menschen müssen bereit sein, auf die Flexibilität und Absicherung zu verzichten, die ein finanzielles „Polster“ ihnen gibt. Ein möglicherweise großer Anteil des ersparten Vermögens wäre plötzlich langfristig gebunden.
Doch ließen sich diese Finanzierungsprobleme nicht mit einer stärkeren Förderung und einer Staffelung nach dem Haushaltseinkommen beheben?
Selbst für die Mitte der Gesellschaft ist die aktuelle Förderung kaum attraktiv
Um das herauszufinden, haben wir die jährlichen Evaluationen des BEG ausgewertet, die unter anderem nach dem sozioökonomischen Status der geförderten Haushalte fragen. In Kombination mit eigenen Berechnungen können wir diese Zahlen erstmals ins Verhältnis zu jenen Haushalten stellen, die Anspruch auf Förderung haben (Abbildung 3).
Das Ergebnis ist ernüchternd: Von einer Million anspruchsberechtigten Haushalten im 10. Einkommensdezil beantragten etwa 40 eine Förderung, während es in den anderen Dezilen jeweils nicht mehr als 12 waren (2021, Panel 1).
Diese massive Unwucht ist über die drei bisher ausgewerteten Jahre eher größer geworden. Der russische Angriffskrieg hat im Jahr 2022 einen deutlichen Zuwachs der Förderanträge ausgelöst, aber das Verteilungsmuster der Antragssteller:innen hat sich nicht verändert. Im Jahr 2023 ist der Abstand zwischen dem 10. Einkommensdezil und allen anderen noch größer geworden.
Abbildung 3
Diese Daten zeigen zwei entscheidende Punkte:
- Die Erklärung für wenig Förderung bei armen Haushalten ist nicht der geringere Immobilienbesitz. Menschen mit geringem Einkommen besitzen selten die vier Wände, in denen sie wohnen. Dennoch sind einkommensschwache Haushalte mit Immobilienbesitz zahlreich: Allein im ersten Einkommensdezil (Singlehaushalt mit einem Monatseinkommen bis 1.200 Euro)[5] gibt es etwa 630.000 Haushalte, die im eigenen Ein- oder Zweifamilienhaus wohnen. Besonders für sie funktioniert das bestehende Förderprogramm nicht. Um sie zu erreichen, könnte die Förderung nach dem Einkommen gestaffelt werden. Darauf zielte die Anfang 2024 eingeführte einkommensbezogene Förderung beim Heizungswechsel ab (Einkommensbonus).
- Bis weit über die Mitte der Einkommensverteilung hinaus gibt es große Zurückhaltung bei der Inanspruchnahme der Förderung.[6] Zumindest theoretisch ließe sich auch das über eine verbesserte Einkommensstaffelung der Förderung beheben. Doch das erscheint uns auf Grundlage dieser Daten kaum zielführend.
Eine Überschlagsrechnung dazu: Würde man die Förderung für die ersten neun Einkommensdezile (jene, in denen Investitionszurückhaltung dominiert) um 10 Prozentpunkte erhöhen, würde das Mehrausgaben für den Bund von etwa 5,5 Milliarden Euro bedeuten. Um die in Abbildung 3 skizzierte Schieflage substanziell zu reduzieren, müsste die Förderhöhe aber um ein Vielfaches stärker erhöht werden.
Was es jetzt braucht: Sanierungskostendeckel statt Gießkannenförderung
Wir glauben: Es gibt klügere Wege als eine Einkommensstaffelung, um die Wärmewende zu beschleunigen, sie sozial gerecht auszugestalten und Finanzierungshürden zu überwinden. Dafür muss den so unterschiedlichen Ausgangssituationen Rechnung getragen werden, indem sich die Förderhöhe an den zu erwartenden Mehrkosten orientiert. Bei jenen Haushalten, wo die Umstellung ohnehin wirtschaftlich ist, würden so auch Fördermittel gespart werden.
Ein Förderprogramm, das hauptsächlich auf die gesamtwirtschaftliche Energieersparnis abzielt, ist vielschichtigen Hürden der Wärmewende jedenfalls nicht mehr angemessen. Außerdem muss die Finanzierbarkeit sichergestellt werden, indem für Haushalte ohne Finanzierungszusage einer Geschäftsbank der Bund (mittelbar über die KfW) direkt einspringt.
Einen detaillierten Vorschlag, wie man einen solchen Sanierungskostendeckel umsetzen kann, arbeiten wir derzeit aus.
Unsere Leseempfehlungen:
- Ein zum Thema passender Klassiker: Seit den 1990er Jahren wird diskutiert, warum Investitionen in Energieeffizienz, die sich wirtschaftlich lohnen, oft nicht getätigt werden. Die Ökonomen A. Jaffe und R. Stavins bieten eine bis heute lesenswerte konzeptionelle Aufarbeitung an.
- Dieser Leitartikel der Financial Times resümiert den Wahlsieg des neuen kanadischen Premiers Mark Carney und blickt auf die schwierige Lage des US-Nachbarstaats im Wirbel von Trumps Zollkrieg.
- Das Bild zu den Ursachen des Blackouts am Montag ist noch unvollständig. A. Chalmers erklärt hier dennoch leicht verständlich, wie solchen Ereignissen in sonnen- und windabhängigen Stromnetzen besser vorgebeugt werden kann.
[1] Ein spannendes Detail: Der Umfang der Maßnahmen, die man aus wirtschaftlicher Sicht am Gebäude vornehmen sollte, um eine Wärmepumpe zu betreiben, ist unabhängig vom Ausgangszustand des Gebäudes.
[2] Die Boxen zeigen hier konventionell das 25. Perzentil, den Median und das 75. Perzentil im jeweiligen Einkommensdezil an. Die Whiskers zeigen das 10. Perzentil und das 90. Perzentil: Da es hier keine einheitliche Methode gibt und die Erhebung von Mikrodaten fehlerbehaftet ist, liegt eine deutliche Bereinigung der Daten nahe.
[3] Maßgeblich liegt das daran, dass Mehrfamilienhäuser „sparsamer“ sind, denn die durchschnittliche Wohnfläche ist geringer und auf jeden Haushalt kommt weniger Außenfläche, die Wärme abgibt.
[4] Ersterer wird bei Heizungswechsel mit einem steuerlichen Jahreseinkommen von unter 40.000 Euro gewährt, letzterer bei Sanierung eines Gebäudes der Energieeffizienzklasse H (Energiebedarf von über 250kWh/m2).
[5] Ein gutes Gefühl für die Einkommensverteilung in Deutschland vermittelt dieser Rechner des IW Köln. Da die Daten von 2019 sind, muss man allerdings die Lohnentwicklung berücksichtigen. Faustregel: Etwa 17 Prozent müssen aufgeschlagen werden, um mit heutigen Einkommen zu vergleichen.
[6] Wir werten hier lediglich die Inanspruchnahme der Förderung von Einzelmaßnahmen aus, nicht jene für die zweite Fördertranche, die auf umfassende Gebäudemodernisierungen abzielt (BEG-WG). Bei dieser ist die soziodemographische Schieflage allerdings noch stärker ausgeprägt.
Medienrück- und Veranstaltungsausblick 30.04.2025
- Rückblick
- Am 10.04. erschien ein Artikel im Handelsblatt zum Fachtext „Wie viel Potenzialwachstums steckt im Koalitionsvertrag?“ des Growth und Budget Labs des DZ.
- Am 10.04.2025 zitierte die taz Dr. Vera Huwe Koalitionsvertrag.
- Am 10.04.2025 zitierte The Pioneer [kostenfreies Abo notwendig] Dr. Florian Schuster-Johnson zum beschlossenen Koalitionsvertrag.
- Am 10.04.2025 wurde die Studie “Wie viel Potenzialwachstum steckt im Koalitionsvertrag?” von Sven von Wangenheim, Saskia Gottschalk und Dr. Florian Schuster-Johnson in der FAZ zitiert.
- Am 10.04.2025 wurde die Studie “Wie viel Potenzialwachstum steckt im Koalitionsvertrag?” von Sven von Wangenheim, Saskia Gottschalk und Dr. Florian Schuster-Johnson n-tv zitiert.
- Am 11.04.2025 wurde Philippa Sigl-Glöckner in einem Beitrag von NDR Info zum Koalitionsvertrag interviewt (Minute 3).
- Am 11.04.2025 erschien ein Gastbeitrag von Philippa Sigl-Glöckner bei Table.Media zum Koalitionsvertrag [kostenloses Abo notwendig].
- Am 13.04.2025 wurde Philippa Sigl-Glöckner in der Newstime (Joyn) zum Koalitionsvertrag und den darin enthaltenen Chancen der jungen Generation interviewt (Folge nicht mehr abrufbar).
- Am 14.04.2025 zitierte Tagesspiegel Background [kostenfreies Abo notwendig] Niklas Illenseer zum Klima- und Transformationsfonds (KTF).
- Am 15.04.2025 hat Philippa Sigl-Glöckner in einem Interview mit n-tv den Koalitionsvertrag bewertet.
- Am 16.04.2025 wurde im Spiegel [entgeltliches Abo notwendig] der Geldbrief „Haben wir die Kapas?“ von Dr. Max Krahé erwähnt.
- Am 17.04.2025 erwähnte Radio Paradiso den Fachtext „Wie viel Potenzialwachstums steckt im Koalitionsvertrag?“ des Growth und Budget Labs des DZ.
- Am 24.04.2025 erwähnte der Spiegel [entgeltliches Abo notwendig] die DZ-Studie zu öffentlichen Finanzierungsbedarfen bis 2030.
- Am 24.04.2025 erwähnte das Handelsblatt den Fachtext „Wie viel Potenzialwachstums steckt im Koalitionsvertrag?“ des Growth und Budget Labs des DZ.
- Am 25.04.2025 war Philippa Sigl-Glöckner zu Gast bei radioeins (RBB) und sprach dort über die Frühjahrstagung vom IMF und der Weltbank.
- Am 26.04.2025 zitierte Politico Ludovic Suttor-Sorel zu potentiellen Chancen für den europäischen Wirtschaftsraum, die sich aus dem Handelskonflikt zwischen den USA und China ergeben könnten.
- Ausblick
- Am 28.05.2025 findet das nächste Event der englischsprachigen Veranstaltungsreihe „Ideas of Energy“ statt, organisiert von der Freigeist-Forschungsgruppe ‘Geopolitics in the Age of Offshore Finance‘ an der FU Berlin, dem Global Public Policy Institute (GPPi) und dem DZ. Zum Thema „Energy and Prices“ wird Brett Christophers sprechen, Professor für Humangeografie (Uppsala Universitet) und Autor von “The Price is wrong – Why Capitalism won’t save the Planet”. Hier geht es zur Anmeldung.
Der Geldbrief ist unser Newsletter zu aktuellen Fragen der Wirtschafts- Fiskal- und Geldpolitik. Über Feedback und Anregungen freuen wir uns. Zusendung an levi.henze[at]dezernatzukunft.org
Hat dir der Artikel gefallen?
Teile unsere Inhalte