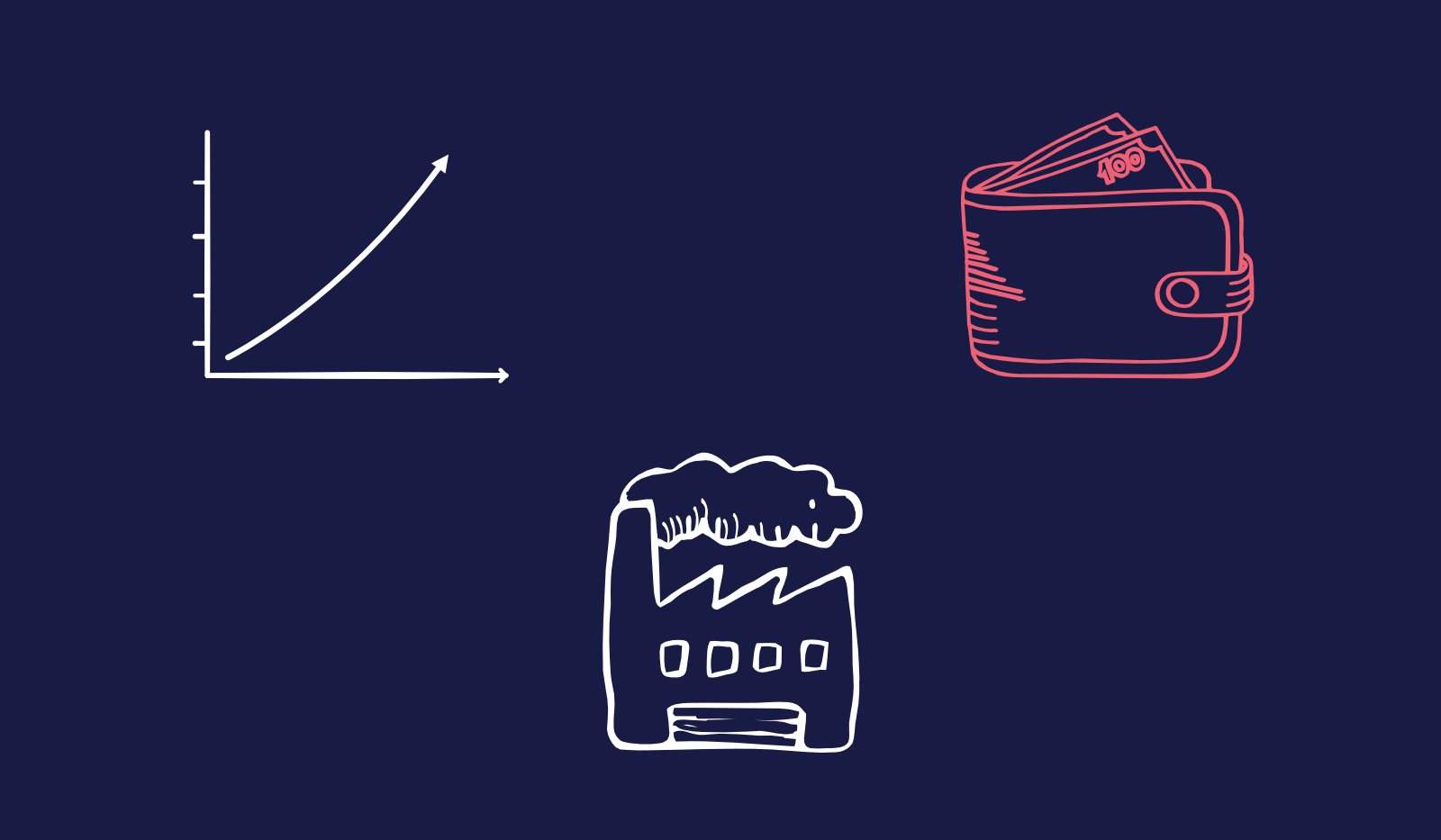
Der Subventionsbericht ist auf einem Auge blind
Niklas Illenseer, Dr. Florian Schuster-Johnson
Die staatlichen Subventionen steigen auf ein Rekordniveau – um mehr als das Dreifache im Vergleich zu 2019. Haupttreiber sind Energiepreisstützen, die kurzfristig Unternehmen und Verbraucher entlasten, langfristig aber den Staatshaushalt belasten. Der Subventionsbericht erscheint außerdem „grüner“ als er ist: Klimawirkungen bleiben oft unkonkret, klimaschädliche Vergünstigungen unberücksichtigt. Zählt man Sozialtransfers hinzu, werden bereits über 300 Milliarden Euro jährlich gebunden – zulasten von öffentlichen Leistungen. Statt pauschaler Preisstützen braucht es gezielte Strategien: Kosten im Energiesystem senken, Arbeitsmarkt besser nutzen, zielgerichtete Industriepolitik fördern.
Die Bundesregierung hat ihren neuen Subventionsbericht vorgelegt. Er beziffert staatliche Finanzhilfen und Steuervergünstigungen für das kommende Jahr auf knapp 78 Milliarden Euro – vor zwei Jahren waren es noch 45 Milliarden (Abbildung 1).[1] Haupttreiber sind die nun kassenwirksame Übernahme der EEG-Kosten durch den Bund (über 18 Milliarden Euro jährlich) und die nun dauerhaft abgesenkte Stromsteuer für Unternehmen (rund 2,5 Milliarden jährlich). Gegenüber 2019 hat sich das Volumen sogar mehr als verdreifacht.
Die Zahl allein ist weder gut noch schlecht. Staatliche Finanzhilfen sind an vielen Stellen geboten, zum Beispiel für den Klimaschutz. Mit Blick auf die absehbaren Haushaltslöcher in den kommenden Jahren ist das steigende Subventionsniveau aber keine Randnotiz: Es verengt den Spielraum dort, wo zukunftsgerichtete öffentliche Leistungen Priorität haben sollten.
Abbildung 1
Grüner Schein?
Was steckt hinter den Zahlen? Der Bericht betont den Fokus auf Klima- und Umweltpolitik: 90 Prozent der Finanzhilfen im Jahr 2025 sollen auf die Klimaziele einzahlen. Das ist richtig in der Ambition. Problematisch ist, dass Klimawirkungen oft nicht konkret beziffert werden, auch weil eine stringente Bewertungsmethodik fehlt.
Mindestens genauso wichtig aus Klimasicht ist, was gar nicht erscheint: Der Bericht folgt weiterhin einem engen Subventionsbegriff und blendet klimapolitisch relevante Vergünstigungen aus, so wie das Dieselprivileg (etwa 7 Milliarden Euro jährlich) oder die Pendlerpauschale (6 Milliarden Euro jährlich). Das Umweltbundesamt stuft sie als klimaschädliche Subventionen ein, doch im Subventionsbericht tauchen sie nicht auf. Die Folge: Die Gesamtbilanz wirkt dadurch grüner, als sie tatsächlich ist.
Klimaschädliche Subventionen funktionieren wie negative CO2-Preise: Sie unterlaufen den Anspruch der Regierung, CO₂ teurer und damit unattraktiver zu machen. Wenn der Staat Emissionen an einer Stelle verteuert, an anderer Stelle aber fossile Nutzung begünstigt, heben sich die Signale gegenseitig auf.
Teuer, temporär – und strategisch falsch
Der tatsächliche Umfang staatlicher Subventionen ist sogar noch viel größer, als es der Subventionsbericht zeigt, denn er blendet noch nicht final entschiedene Vergünstigungen aus, wie die reduzierte Mehrwertsteuer in der Gastronomie, die Rückkehr zum Agrardieselrabatt oder die neuen Netzentgeltzuschüsse. Jetzt schon erklärt sich der Anstieg der Hilfen durch hohe Energiepreissubventionen und es erscheinen noch mehr davon am Horizont.
Der neue Netzentgeltzuschuss und die gesenkte Stromsteuer für die Industrie kosten zusammen jährlich rund 11 Milliarden Euro. Insgesamt subventioniert der Staat den Energieverbrauch inzwischen mit etwa 38 Milliarden Euro pro Jahr, ein neuer Industriestrompreis ist bereits angekündigt.
Kurzfristig stützen solche Maßnahmen die Konjunktur. Doch sind die durchschnittlichen Preise für Industriestrom nach dem Krisenhöchststand wieder deutlich günstiger und lagen 2024 wieder leicht unter Vorkrisenstand. Damit sind die Energiekosten dort angekommen, wo sie auch langfristig bleiben werden – und damit höher als in vielen anderen Ländern. Geschäftsmodelle, die auf niedrige Energiepreise angewiesen sind, kommen deshalb dauerhaft nicht ohne staatliche Hilfe aus. Das bindet einen erheblichen Teil des Bundeshaushalts, der für Ausgaben, die das Wachstum fördern, somit nicht mehr verfügbar ist.
Abbildung 2
Höhere Stromkosten als vor der Krise tragen heute vor allem die energieintensiven Branchen. Sie profitieren allerdings nicht von der jüngsten Stromsteuersenkung, weil sie zuvor schon ausgenommen waren. Umgekehrt lässt sich der aktuelle Rückbau in Automobil- und Maschinenbau nicht über Strompreise erklären: Beide gelten nicht als energieintensive Sektoren. Anstelle pauschaler Entlastungen sind zielgerichtete industriepolitische Maßnahmen gefragt.
Der Bundeshaushalt droht zum Subventionshaushalt zu werden
Generell ist der Bundeshaushalt wesentlich stärker von Subventionen geprägt, als der Subventionsbericht vermuten lässt. Denn er betrachtet vor allem Hilfen an Unternehmen; der viel größere Teil geht an Haushalte. Auch Sozialtransfers sind letztlich Subventionen, weil sie Menschen, die von allein nicht genug fürs Leben verdienen, finanziell unter die Arme greifen. Wir nennen sie Survival-Subventionen (rund 250 Milliarden Euro) und erfassen sie in unserem Haushaltstracker. Rechnet man sie hinzu, droht der finanzielle Gestaltungsspielraum bis 2035 nahezu zu verschwinden. Für öffentliche Leistungen für Bildung, Sicherheit, Infrastruktur und Dekarbonisierung bleibt dann kaum Geld übrig.
Abbildung 3
Will die Bundesregierung das vermeiden, sollte sie daran arbeiten, die Notwendigkeit für Subventionen dauerhaft zu reduzieren. Der Ausweg sind nicht pauschale Kürzungsmantras, sondern über Politik, die etwa mehr Frauen aus der Teilzeitfalle befreit, Arbeitslose wirklich in Arbeit bringt oder Ältere zum längeren Weiterarbeiten motiviert. Das wirkt doppelt, denn es bringt Menschen nicht nur mehr Geld ins Portemonnaie: Wer mehr arbeitet und ein höheres Lebenseinkommen verdient, zahlt mehr Steuern und Abgaben, und muss weniger subventioniert werden. Nötig sind dafür bessere öffentliche Leistungen, zum Beispiel mehr und bessere Kitas, Pflegeinfrastruktur, Qualifizierungsmaßnahmen et cetera. Und damit genau für solche Ausgaben, für die durch immer mehr Subventionen das Geld fehlt.
Weniger Preisstützen, mehr Wachstumsstrategien
Der Subventionsbericht dokumentiert steigende Entlastungen und zeigt zugleich vieles nicht. Solange klimaschädliche Vergünstigungen nicht erfasst werden, unterschätzen wir die ökologische Schieflage. Solange wir Sozialtransfers nicht als fiskalische Bindungen mitdenken, überschätzen wir den politischen Spielraum. Und wenn Energiepreise subventioniert werden, statt Energiesystemkosten zu senken und gezielte Industriepolitik voranzutreiben, fördern wir Wirtschaftsmodelle von gestern.
Die Alternative: Subventionen runter, Systemkosten senken, Arbeitsmarkt auslasten. Das ist weniger spektakulär als die nächste Preisbremse – aber die einzige Strategie, die Wachstum ermöglicht, Klimaziele konsequent umsetzt und den Bundeshaushalt nachhaltig aufstellt.
Unsere Leseempfehlungen:
- Ausführliche Informationen und die Berechnungsmethode zu unseren Fiscal-Space-Indikator bietet unser Policy Paper.
- Alle Details zum Bundeshaushalt finden sich in unserem Haushaltstracker, ergänzt um einen Datensatz mit allen Einzeltiteln aus Kernhaushalt und Sondervermögen.
- In diesem Beitrag analysiert Klaus Seipp die Entwicklung der Strompreise in den vergangenen Jahren mit besonderem Fokus auf die Folgen und Überwindung des Energiepreisschocks.
Medienbericht 11.09.2025
Medienerwähnungen und Auftritte
- Rückblick
- Am 21.08.2025 erschien der berlin bubble Newsletter und schrieb über unseren Fiscal-Space-Indikator.
- Am 21.08.2025 veröffentlichte der Bundestag Philippa Sigl-Glöckners Stellungnahme zum Haushaltsbegleitgesetz 2025 für die Anhörung im Haushaltsausschuss.
- Am 22.08.2025 war Philippa Sigl-Glöckner zu Gast bei WELT TV und sprach über die aktuellen BIP-Prognosen und den stagnierenden Konsum in Deutschland.
- Am 22.08.2025 zitierte die taz Florian Schuster-Johnson zur neuen BIP-Schätzung und der deutschen Exportabhängigkeit.
- Am 25.08.2025 zitierte der Tagesspiegel Philippa Sigl-Glöckners Aussagen aus der Anhörung des Haushaltsauschusses.
- Am 26.08.2025 war Philippa Sigl-Glöckner zu Gast bei WELT TV und sprach über die Notwendigkeit, mehr Menschen in Arbeit zu bringen.
- Am 26.08.2025 zitierte die taz Florian Schuster-Johnson zum geplanten Stellenabbau in der Autoindustrie.
- Am 27.08.2025 schrieb die Frankfurter Rundschau über das düsterte Konsum-Klima in Deutschland du zitierte Philippa Sigl-Glöckner und Florian Schuster-Johnson.
- Am 27.08.2025 schrieb Business Punk über den fehlenden Konsum in Deutschland und zitierte Philippa Sigl-Glöckner.
- Am 28.08.2025 veröffentlichte der Tagesspiegel Background eine Analyse des KTF und zitierte Niklas Illenseer zur fehlenden strategischen Leitlinie.
- Am 01.09.2025 berichtete der Spiegel über den Bundeshaushalt 2025 und zitierte Philippa Sigl-Glöckner zur Wirksamkeit und Zulässigkeit der Neuverschuldung.
- Am 05.09.2025 zitierte das Handelsblatt Florian Schuster-Johnson zu den Buchungstricks der Bundesbank.
- Am 09.09.2025 interviewte ZDF frontal Philippa Sigl-Glöckner zu den geplanten Sozialstaatreformen.
Fußnoten
[1] 2023 wurden etwa 18 Milliarden Euro weniger ausgegeben als veranschlagt, was diesen Sprung größer wirken lässt, als er sein könnte. Denn die tatsächliche Verausgabung bleibt oft hinter der Veranschlagung zurück.
Der Geldbrief ist unser Newsletter zu aktuellen Fragen der Wirtschafts-, Fiskal- und Geldpolitik. Über Feedback und Anregungen freuen wir uns. Zusendung an niklas.illenseer[at]dezernatzukunft.org
Hat dir der Artikel gefallen?
Teile unsere Inhalte



