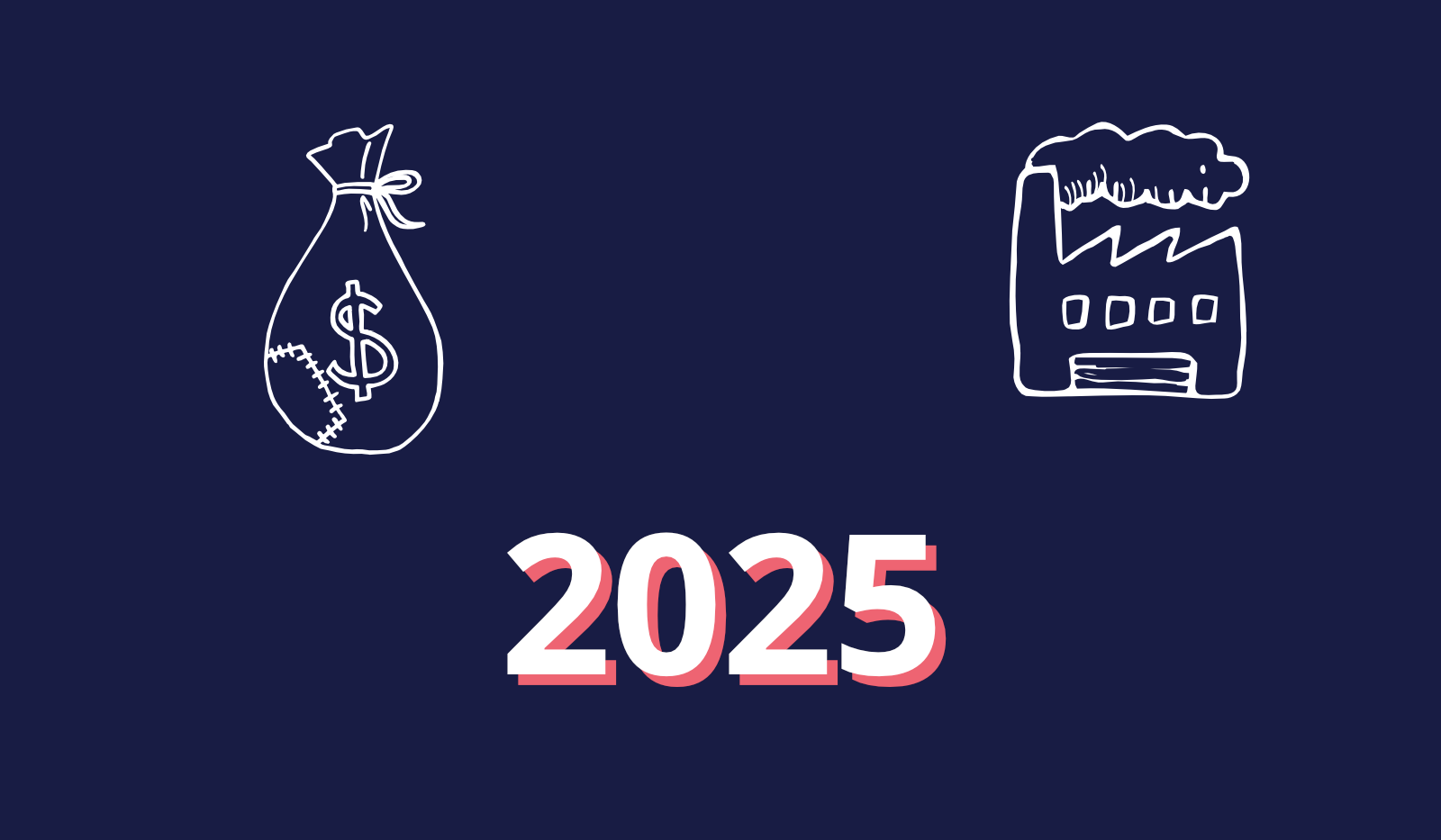Wie schlimm ist die Zinsrampe?
Philippa Sigl-Glöckner, Leo Mühlenweg, Max Krahé
In den letzten Wochen verwies der Finanzminister gerne darauf, dass sich die Zinsausgaben seit 2021 verzehnfacht hätten. Unterlegt wurde die Botschaft in den sozialen Medien mit einem furchteinflößenden Chart. In diesem Geldbrief – eine Kollaboration von Dezernat Zukunft mit FiscalFuture – diskutieren wir, was dieser Chart für die Finanzpolitik bedeutet und stoßen auf einen special effect der staatlichen Buchhaltung.
Abbildung 1
Buchhaltungsmagie
Durch die Zinserhöhungen der EZB erhöhen sich auch die Finanzierungskosten von Staatsschulden. Die Renditen auf deutsche 10-jährige Staatsanleihen sind beispielsweise von -0,31% in 2021 auf zuletzt 2,62% gestiegen. Für eine Verzehnfachung der Zinskosten reicht dies allerdings nicht aus. Die durchschnittliche Laufzeit aller ausstehenden Bundesanleihen ist knapp sieben Jahre, sodass pro Jahr nur grob 14% der Bundesschuld zu den nun höheren Zinsen refinanziert werden muss. 86% der Bundesschuld bleibt also zunächst unberührt vom Anstieg.
Wie kann das Bundesfinanzministerium trotzdem eine Verzehnfachung ausweisen? Zentral dafür ist eine umstrittene Buchungsregel. Um diese zu verstehen, muss man sich die Zahlungsströme ansehen, die mit dem Staatsanleihengeschäft einhergehen.
Gibt der Staat eine Staatsanleihe zum Nennwert von 100 Euro aus, bekommt er in den seltensten Fällen vom Käufer genau 100 Euro dafür. Ist der Zins der Anleihe höher als der Marktzins, zahlt der Käufer gerne mehr, um sich die verhältnismäßig hohe Verzinsung zu sichern. Dies war in den letzten Jahren häufig der Fall. So bekam der Bund zuletzt für die Aufstockung einer 30-jährigen Staatsanleihe mit einem Zinskupon von 4,25% einen durchschnittlichen Preis von 119 Euro gezahlt.[1] Der Staat bekam also einen Aufschlag dafür, dass der Kunde eine Wertanlage mit so guter Verzinsung erhält. Dieser Aufschlag nennt sich Agio. Gibt der Staat andererseits Anleihen mit besonders niedriger Verzinsung aus, zahlen die Käufer oft weniger als den Nennwert. Man spricht in diesem Fall von einem Disagio.
Die Frage ist nun, wie man Agien und Disagien richtig verbucht. Die Bundesregierung hat sich dafür entschieden, alle daraus entstehenden Mehr- oder Mindereinnahmen im Ausgabejahr der Anleihe zu verbuchen. Das macht die Ausgabe von Anleihen mit hohen Agio-Einnahmen (und entsprechend hohen Zinsen) für den Staat attraktiv. Das Agio kann man sich heute voll gutschreiben, während die höheren Zinskosten erst in der Zukunft gezahlt werden müssen. Andersherum ist es nachteilig, heute Anleihen mit niedrigem Zins auszugeben, da man das entstehende Disagio voll im Entstehungsjahr anrechnen muss, aber erst zukünftige Regierungen von den niedrigen Zinsen profitieren.
2020 und 2021 wurden besonders viele Agien gezahlt, da die EZB den Zins 2019 unter null abgesenkt hatte. Weil erwartet wurde, dass die Leitzinsen noch lange niedrig bleiben würden (“low for long”), fiel auch die Rendite der Staatsanleihen ins Negative. Da der Staat keine Anleihen mit negativen Zinsen emittiert und zusätzlich Anleihen mit höheren Zinsen aufgestockt[2] oder aus dem Eigenbestand[3] verkauft wurden, waren Käufer häufig bereit, einen hohen Aufschlag zu zahlen.
2023 ist voraussichtlich das Gegenteil der Fall: Es werden hohe Disagien projiziert. Stockt der Staat aktuell Anleihen mit niedrigen Zinsen auf, sind Käufer nur noch zu einem deutlich niedrigeren Preis bereit, diese zu kaufen, da sie höher verzinste Alternativen haben. Eine im August 2019 neuemittierte 30-jährige Anleihe mit einem Zins von Null wird beispielsweise aktuell zu einem Kurs von 50,4 gehandelt. Diese Anleihe wird am 15.03 im Wert von einer Milliarde Euro aufgestockt. Bleibt der Kurs bei 50,4, bedeutet dies, dass der der Staat lediglich 504 Millionen Euro für die Anleihen mit einem Nennwert von einer Milliarde erhält. Er hat folglich Disagio-Kosten in Höhe von 496 Millionen Euro.
Diese Kosten werden im Bundeshaushalt vollständig als Zinskosten des Jahres 2023 verbucht. Würde man die Zinskosten andererseits gleichmäßig über die Laufzeit der Anleihe verteilen, wären die Disagio-Kosten dieser Aufstockung in 2023 lediglich ca. 18 Millionen Euro. Die beeindruckende Verzehnfachung der Zinszahlungen ist zu erheblichen Teilen ein Buchungsartefakt.
Abbildung 2 Verbucht man die Disagio-Kosten periodengerecht, bzw. verteilt man die Disagio-Kosten gleichmäßig über die Laufzeit der Anleihe, ergibt sich ein anderes Bild als das von Finanzminister Lindner gezeichnete. Eurostat weist diese Zahlen für den Gesamtstaat aus, sprich Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherungen zusammen (s. Abbildung 3). Die Zinsausgaben steigen auch in dieser Buchungsmethode. Jedoch handelt es sich nun um einen Anstieg von 21 Mrd. Euro im Jahr 2021 (1,1% aller gesamtstaatlicher Ausgaben) auf 28 Mrd. Euro im Jahr 2023 (1,4%), sprich ein Wachstum von 36%. Die explosionsartige Verzehnfachung von knapp 4 Mrd. Euro auf 40 Mrd. Euro, die von Finanzminister Lindner ausgewiesen wurde, erweist sich also weitgehend als Artefakt der bundesdeutschen Buchungsregeln.
Verbucht man die Disagio-Kosten periodengerecht, bzw. verteilt man die Disagio-Kosten gleichmäßig über die Laufzeit der Anleihe, ergibt sich ein anderes Bild als das von Finanzminister Lindner gezeichnete. Eurostat weist diese Zahlen für den Gesamtstaat aus, sprich Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherungen zusammen (s. Abbildung 3). Die Zinsausgaben steigen auch in dieser Buchungsmethode. Jedoch handelt es sich nun um einen Anstieg von 21 Mrd. Euro im Jahr 2021 (1,1% aller gesamtstaatlicher Ausgaben) auf 28 Mrd. Euro im Jahr 2023 (1,4%), sprich ein Wachstum von 36%. Die explosionsartige Verzehnfachung von knapp 4 Mrd. Euro auf 40 Mrd. Euro, die von Finanzminister Lindner ausgewiesen wurde, erweist sich also weitgehend als Artefakt der bundesdeutschen Buchungsregeln.
Abbildung 3 Der Vorschlag einer periodengerechten Verbuchung ist dabei nicht neu. So haben sowohl der Wissenschaftliche Beirat des BMF, die Bundesbank als auch der Bundesrechnungshof dies in der Vergangenheit vorgeschlagen. Spätestens jetzt wäre es an der Zeit, die lange geforderte Änderung der Buchhaltungsregelungen durchzuführen, da das aktuelle Verfahren nicht nur den Haushalt intransparenter macht, sondern auch ein effizientes Schuldenmanagement erschwert. Der Staat sollte die Kosten seiner Verschuldung kennen und die eigenen Anreize nicht durch kurzsichtige Buchhaltungsmethoden aus dem Mittelalter verzerren.
Der Vorschlag einer periodengerechten Verbuchung ist dabei nicht neu. So haben sowohl der Wissenschaftliche Beirat des BMF, die Bundesbank als auch der Bundesrechnungshof dies in der Vergangenheit vorgeschlagen. Spätestens jetzt wäre es an der Zeit, die lange geforderte Änderung der Buchhaltungsregelungen durchzuführen, da das aktuelle Verfahren nicht nur den Haushalt intransparenter macht, sondern auch ein effizientes Schuldenmanagement erschwert. Der Staat sollte die Kosten seiner Verschuldung kennen und die eigenen Anreize nicht durch kurzsichtige Buchhaltungsmethoden aus dem Mittelalter verzerren.
Neben den hohen Disagio-Kosten gibt es noch einen weiteren Faktor, der den momentanen Anstieg der Zinskosten maßgeblich prägt: Die Einzahlungen auf ein Sondervermögen für die Schlusszahlung inflationsindexierter Bundeswertpapiere (ILB). Diese sind ausgewiesen in türkis in Abbildung 2. Bei den ILBs wird der Nennwert an die Inflation gekoppelt. Der zurückzuzahlende Betrag ist der Nennwert multipliziert mit der Veränderung des Preisniveaus. Um diese Schlusszahlungen in Zukunft bewältigen zu können, wurde ein Sondervermögen eingerichtet, auf welches die inflationsabhängige Veränderung der Schlusszahlung eingezahlt wird. Diese Kosten sind durch die aktuell hohe Inflation deutlich gestiegen, sollten in den kommenden Jahren mit einer Abflachung der Inflation allerdings wieder zurückgehen.
Alles also kein Problem?
Es allein bei dieser buchhalterischen Bereinigung bewenden zu lassen, wäre aber zu kurz gesprungen. Das Zinsumfeld hat sich durch die Geldpolitik der EZB rapide verändert. Die Frage, ob man in diesem geänderten Umfeld staatliche Verschuldung anders einschätzt, ist mehr als berechtigt. Wie problematisch sind also die jetzigen Zinssteigerungen?
In unserem Papier zu einer neuen deutschen Finanzpolitik hatten wir einen Frühwarnindikator für Zinskosten vorgeschlagen. Sobald sich die Zinskosten als Anteil des Bundeshaushalts um einen Prozentpunkt erhöhen, sollte der Staat seine fiskalpolitische Strategie überprüfen. Folgt man den europäischen Buchhaltungsregelungen und der Prognose der europäischen Kommission ist dieser Punkt noch nicht erreicht. Es gab allerdings einen deutlichen Anstieg.
Das gibt unserer Einschätzung nach Anlass dazu, nun besonders stark auf ein bestimmtes Verhältnis zu achten: Die Differenz zwischen (nominalem) Wachstum und Zinsen. Liegen die Zinsen über der Wachstumsrate, wachsen die Schulden schneller als die Wirtschaft; die Schuldenquote würde also auch bei ausgeglichenen oder leicht überschüssigen Haushalten wachsen. Ist es umgekehrt, sprich Wachstum größer Zinsen, schmilzt die Schuldenquote auch bei ausgeglichenen oder leicht defizitären Haushalten von alleine ab. Dieser Beitrag des Verhältnisses von Zinsen und Wachstum zur Entwicklung der Schulden wird Schneeballeffekt genannt. Die EU berechnet ihn jedes Jahr und gibt eine Prognose ab. Für Deutschland fällt dieser Effekt aktuell sehr günstig aus, da die Inflation wesentlich stärker gestiegen ist als die durchschnittliche Verzinsung der Staatsverschuldung.
Abbildung 4 Daher gibt es unserer Ansicht nach gerade noch keinen Grund, zwanghaft Neuverschuldung zu vermeiden. Es spricht aber alles für einen Fokus auf das Verhältnis zwischen Zinsen und Wachstum. Nach unserer Einschätzung wird die Inflation abflauen, während die Durchschnittszinsen auf die Staatsverschuldung schrittweise ansteigen. Der Schneeballeffekt wird in den nächsten Jahren also aller Wahrscheinlichkeit nach weniger günstig ausfallen.
Daher gibt es unserer Ansicht nach gerade noch keinen Grund, zwanghaft Neuverschuldung zu vermeiden. Es spricht aber alles für einen Fokus auf das Verhältnis zwischen Zinsen und Wachstum. Nach unserer Einschätzung wird die Inflation abflauen, während die Durchschnittszinsen auf die Staatsverschuldung schrittweise ansteigen. Der Schneeballeffekt wird in den nächsten Jahren also aller Wahrscheinlichkeit nach weniger günstig ausfallen.
Das bedeutet für die Finanzpolitik konkret zweierlei: Zum einen sollten wir bei „one-off“ Ausgaben – wie zum Beispiel für die Krisenbekämpfung – überlegen, welche Volumen wirklich nötig sind. 2022 war die Bundesregierung bereit, fast das Volumen eines kompletten Bundeshaushalts zur Krisenbekämpfung aufzuwenden. In den Coronajahren war man ähnlich großzügig. Solche Krisenbekämpfung ist wichtig, um langfristige Schäden zu vermeiden. Aber sie ist teuer.
Abbildung 5 Auf der anderen Seite scheint es heute besonders sinnvoll, sich mehr um das eigene Wachstum zu kümmern. Denn während für die Krisen viel Geld locker gemacht wurde, knausert man jetzt an Ausgaben, die essenziell für unseren zukünftigen wirtschaftlichen Erfolg sind: von erneuerbaren Energien über Bildung und Erziehung bis zur Bahninfrastruktur. Auch eine schlagkräftige europäische Antwort auf den IRA bleibt aus.
Auf der anderen Seite scheint es heute besonders sinnvoll, sich mehr um das eigene Wachstum zu kümmern. Denn während für die Krisen viel Geld locker gemacht wurde, knausert man jetzt an Ausgaben, die essenziell für unseren zukünftigen wirtschaftlichen Erfolg sind: von erneuerbaren Energien über Bildung und Erziehung bis zur Bahninfrastruktur. Auch eine schlagkräftige europäische Antwort auf den IRA bleibt aus.
Wir geben also heute in Krisen viel aus, fahren aber mit strukturell angezogener Handbremse, wenn es darum geht, Wachstum und gute Beschäftigung langfristig zu sichern. Dabei spielt das Wachstum eine wesentliche Rolle für den Schneeballeffekt und damit die tatsächliche Tragfähigkeit der Schulden.
Darüber hinaus sind Wachstum und Beschäftigung auch ganz konkret für den Bundeshaushalt und sein jährliches Saldo wichtig: Denn vom Wachstum hängen die Steuereinnahmen ab und von den Einkommen der Beschäftigten die nötigen Subventionen für die Rente. Sowohl die Steuereffekte von Wachstum als auch die Effekte, die Wachstum auf das notwendige Volumen an staatlichen Zuschüssen zur Rente hat, sind wesentlich größere Hebel für nachhaltige Staatsfinanzen als die Zinskosten.
Es ist also absolut richtig, dieser Tage genauer auf die Staatsfinanzen zu schauen. Vielleicht wäre auch ein Mehr an Haushaltstransparenz, ein Weniger an Sondervermögen, nicht verkehrt. Nur sollten wir vermeiden, dass uns der kurzfristige Fokus auf die Zinsen — oder noch schlimmer, mittelalterliche Buchhaltungsmethoden — den Blick auf die großen Herausforderungen verstellt.
Erratum: In dem Lesebeispiel zu Abbildung 2 sind uns zwei Fehler unterlaufen. Es handelt sich um 14 Milliarden Euro an klassischen Zinszahlungen und nicht 10,8 Milliarden Euro. Anstatt von 10,8 Milliarden Euro Einnahmen durch Agien, sind es 10,9 Milliarden Euro. Wir haben die Fehler entsprechend korrigiert.
Fußnoten
[1] Aufstockung der Anleihe mit der ISIN DE0001135325.
[2] Der Bund ist allgemein an großen liquiden Anleihen interessiert, da diese die Finanzierungskosten insgesamt tendenziell senken. Aus diesem Grund emittiert er nicht jedes Mal eine neue Anleihe, sondern stockt bereits bestehende Anleihen zu gleichen Konditionen auf. Theoretisch könnte das Problem der (Dis)agien auch gelöst werden, indem der Staat Anleihen immer neuemittiert. Dies würde allerdings möglicherweise dem Ziel möglichst niedriger Finanzierungskosten entgegenlaufen.
[3] Der Bund hält meistens einen gewissen Teil der ausgegebenen Anleihen zur Marktpflege zurück, um mit diesen beispielsweise die Liquidität später unterstützen zu können. Werden Wertpapiere aus dem Eigenbestand verkauft, deren Zins-Kupon oberhalb der Marktrendite liegt, entstehen Agien. Ist es andersherum, entstehen Disagien.
Medien- und Veranstaltungsbericht 10.03.2023
- Medienerwähnungen und Auftritte
- Am 24.02.23 war Philippa in einem Interview im materialist und plädiert für einen grundlegenden Wandel in der Wirtschafts- und Finanzpolitik.
- Am 25.02.23 war Philippa im Bayrischen Rundfunk bei Bayern 2 am Samstagvormittag zu Gast.
- Am 28.02.23 hat Philippa ein Statement im Rahmen einer Anhörung in einer Plenarsitzung der Europäischen Parlamentswoche gegeben, zum Thema „Review of the EU economic governance framework“. Die Aufnahme findet sich hier, ihr Statement hier und ihre Folien hier.
- Am 01.03.23 wurde Philippas Tweet zu ihrem Hearing im EU-Parlament im EuroIntelligence Newsletter erwähnt.
- Am 01.03.23 wurden Ausschnitte von Philippas Statement beim Hearing im EU-Parlament im italienischen TV-Sender Le Cronache gezeigt.
- Am 11.04.23 wird Philippa zusammen mit Andrea Binder bei Planet Wissen im WDR zu sehen sein. Der Titel der Sendung lautet „Geld aus dem Nichts — Wann kommt der nächste Finanzcrash?“ und läuft um 10:55 Uhr. Anschließend steht die Sendung in der ARD Mediathek zur Verfügung.
- Veranstaltungen
- Am 30. und 31. März findet in Rom das erste Treffen des European Macro Policy Network Der zweite Tag ist öffentlich: Zur Anmeldung und den Programmdetails geht es hier. Für alle, die es nicht nach Rom schaffen können, gibt es einen Livestream. Ein besonderes Highlight wird die Keynote von Adam Tooze sein (12:00-13:30).
- Am 16.03.23 findet in Kooperation mit Fiscal Future wieder eine Ökonom:innenrunde statt, diesmal mit Anne Schwenk. Weitere Infos und den Link zur Anmeldung findet ihr hier.
Der Geldbrief ist unser Newsletter zu aktuellen Fragen der Geldpolitik und der Finanzmärkte. Über Feedback und Anregungen freuen wir uns und erbitten deren Zusendung an philippa.sigl-gloeckner[at]dezernatzukunft.org
Hat dir der Artikel gefallen?
Teile unsere Inhalte