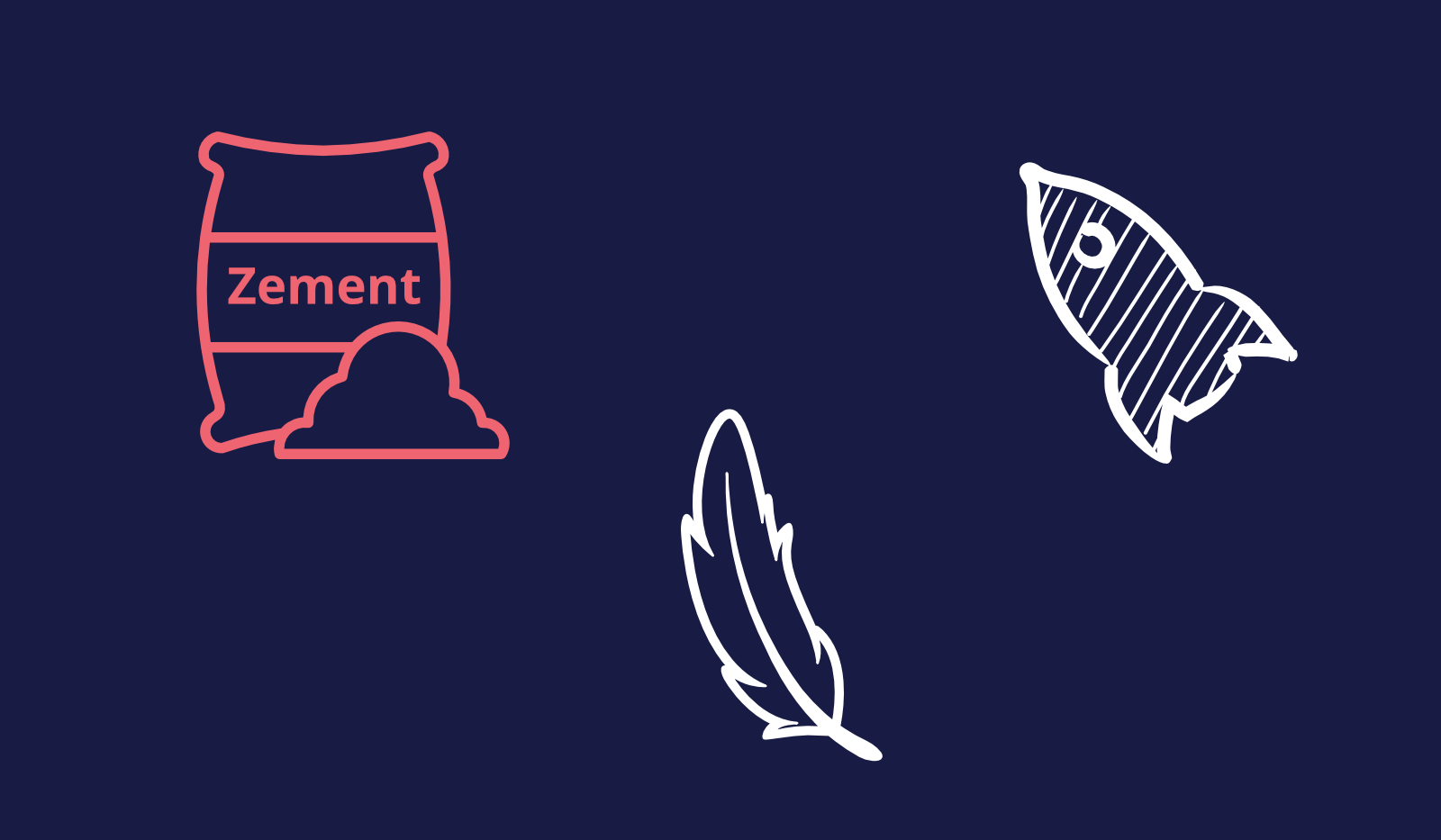
Völlig losgelöst: Warum Preise wie Raketen steigen, aber wie Federn fallen
Aurora Li, Nils Gerresheim
Ab 2022 stiegen die Preise im Zementsektor sprunghaft an und verharren seither auf einem hohen Niveau. In der Forschung werden dafür meist drei Ursachen genannt: asymmetrische Anpassungskosten, Preiswahrnehmung auf der Nachfrageseite und Marktmacht auf der Angebotsseite. Für den Zementmarkt spricht vieles dafür, dass vor allem die letzten beiden Faktoren dominieren.
Inflation ist ein komplexes Phänomen und muss entsprechend differenziert betrachtet werden. Um ein besseres Verständnis davon zu gewinnen, wie sich Preise entwickeln, analysieren wir diese regelmäßig bis auf die Ebene einzelner Sektoren – beispielsweise mit unserem Supply Side Monitor. So hat z. B. unsere Kollegin Sara Schulte zuletzt die Entwicklungen auf dem Kaffeemarkt untersucht.
In der folgenden Analyse blicken wir auf ein besonderes Muster der Preisbildung, das als „Rocket and Feathers“-Phänomen bekannt ist. Dieses beschreibt eine asymmetrische Preisreaktion: Während Preise bei steigenden Kosten rasch und deutlich ansteigen, wie eine Rakete eben, sinken Preise bei fallenden Kosten deutlich langsamer, ähnlich einer Feder.
Eine solche Preisdynamik konnte in den letzten Jahren am Zementmarkt beobachtet werden (Abbildung 1). Ab 2022 stiegen die Inputkosten in diesem Sektor deutlich, insbesondere durch stark erhöhte Energiepreise (Abbildung 1). Der Energiekostenanteil beträgt in normalinflationären Phasen laut dem deutschen Zementverband mehr als 30 Prozent an der Bruttowertschöpfung. Dazu kam weiterer Kostendruck aufgrund sinkender Nachfrage in der Baubranche, der Hauptabsatzbranche des Zementsektors (Abbildung 2).
Abbildung 1
Die Preise im Zementsektor bilden sich in der Regel über jährliche Preislisten zu Beginn des Jahres, ergänzt durch indexierte Aufschläge, beispielsweise für Energiepreiskosten. Dadurch erklärt sich der signifikante Preisanstieg zu Beginn des Jahres 2023. Das Statistische Bundesamt meldete für das erste Halbjahr 2023 einen Anstieg der Zementpreise um rund 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Als die Energiepreise ab dem zweiten Halbjahr 2022 sanken und sich die Baubranche allmählig erholte, blieben die Zementpreise konstant auf hohem Niveau.
Abbildung 2
Im gleichen Zeitraum stiegen die Bruttogehälter nur leicht, und auch der Branchenumsatz in Deutschland folgte weiterhin einem moderaten Aufwärtstrend (Abbildung 3). Es gibt daher wenig Hinweise darauf, dass sinkende Energiekosten im selben Maße durch steigende Personalkosten kompensiert wurden.
Abbildung 3
Was ist also die Ursache einer „Rocket and Feathers“-Preisentwicklung? In der Literatur werden vor allem zwei Erklärungsansätze hervorgehoben: Asymmetrische Anpassungskosten und variierende Preissensitivität der Nachfrageseite in Kombination mit Marktmacht.
Teure Expansion, günstige Drosselung
Wie Peltzman (2000) hervorhebt, können asymmetrische Anpassungskosten der Unternehmen das „Rocket and Feathers“-Phänomen erzeugen. Inputpreise spiegeln sich nicht unmittelbar und gleichmäßig in den marginalen Grenzkosten wider, also jenen zusätzlichen Kosten, die bei der Produktion einer weiteren Einheit entstehen.
Bei steigenden Inputkosten ist es für Unternehmen vergleichsweise einfach, das Produktionsvolumen zu reduzieren, beispielsweise dadurch die Produktion zu drosseln oder durch die geringere Auslastung bestehender Kapazitäten. Eine Ausweitung der Produktion bei sinkenden Kosten erfordert hingegen deutlich höhere Investitionen, etwa in zusätzliche Produktionsanlagen oder die Rekrutierung und Schulung von Personal. Die Kostenstruktur für eine Reduktion versus eine Expansion des Outputs ist somit nicht symmetrisch. In der Folge reagieren Preise auf Kostensteigerungen schneller und ausgeprägter als auf Kostensenkungen.
Abbildung 4
Ein Blick auf die Produktion der deutschen Zementindustrie zeigt ab Anfang 2022 einen deutlichen Rückgang, der bis Mitte des Jahres anhält und seither auf einem niedrigen Niveau mit leicht negativem Trend verharrt (Abbildung 4, links). Im Gegensatz dazu bewegen sich die Beschäftigungszahlen seit 2021 in einem leichten positiven Trend (Abbildung 4, rechts).
Die Analyse der gemeldeten Produktionshemmnisse liefert ein differenziertes Bild (Abbildung 5): Neben den stark gestiegenen Energiepreisen waren insbesondere Materialengpässe zwischen 2021 und 2023 ein zentraler Hemmfaktor. Auch Kapazitätsengpässe wurden regelmäßig gemeldet. Beide Faktoren verstärken den Preisdruck zusätzlich zu den Energiekosten. Mit dem Rückgang der Nachfrage aus der Bauwirtschaft ab Anfang 2022 gingen die Kapazitätsengpässe im Zementsektor erst mit zeitlicher Verzögerung ab Beginn 2023 zurück.
Abbildung 5
Trotz einer leichten Erholung der Baukonjunktur ab Anfang 2023 haben sich die Produktionsvolumina bislang nicht auf das vorherige Niveau zurückentwickelt. Eine Erklärung liegt in den hohen Investitionskosten für die Ausweitung von Produktionskapazitäten: Laut dem europäischen Zementverband belaufen sich die Kosten für den Aufbau neuer Produktionsanlagen auf rund 150 Millionen Euro pro Million Tonnen Jahreskapazität. Dies entspricht einem Investitionsvolumen, das etwa dem Umsatz von 30 Jahren entspricht. Die steigenden Meldungen zu Überstunden können als kurzfristige Maßnahme zur Kompensation begrenzter Kapazitäten interpretiert werden.
Auffällig ist jedoch, dass seit 2023 auch die Meldungen zu mangelnden Aufträgen deutlich zunehmen (wenn auch volatil). Dieses scheinbar widersprüchliche Bild lässt sich möglicherweise durch die stark regional strukturierten Märkte der Zementbranche erklären, in denen die Auftragslage je nach Standort erheblich variieren kann. Dazu später mehr.
Preisblind auf der Nachfrageseite
Ein weiterer Erklärungsansatz für das „Rocket and Feathers“-Phänomen beruht auf variierender Aufmerksamkeit der Nachfrageseite in Kombination mit Marktmacht auf der Angebotsseite. Tappata (2009) zeigte für die Nachfrageseite: sobald sich Preise verändern, sind die Nachfrager aufmerksamer. Wenn Produzent:innen wegen gestiegener Kosten ihre Preise erhöhen, dann beginnt die Nachfrageseite die Preisentwicklung aufmerksamer zu verfolgen und Preise zu vergleichen. In der Folge steigt die Preiselastizität der Nachfrage, was den Wettbewerb innerhalb des Sektors erhöht. Unternehmen geraten unter Druck, ihre Margen zu reduzieren und ihre Produkte näher an den marginalen Kosten anzubieten.
Wenn Inputkosten sinken, bleibt dieser Wettbewerbseffekt jedoch aus. Konsument:innen nehmen die Preisveränderungen nicht unmittelbar wahr und akzeptieren bestehende Preise als gegeben. Die Preiselastizität sinkt, es findet keine verstärkte Suche nach günstigeren Angeboten statt, und der Wettbewerbsdruck bleibt aus. Tendenziell können Unternehmen ihre Preise trotz gesunkener Kosten auf einem hohen Niveau halten.
Diese Dynamik lässt sich auch im Zementmarkt beobachten. Im Jahr 2022 kam es beispielsweise beim größten deutschen Zementhersteller, Heidelberg Materials, zu außerordentlichen Anpassungen der Preislisten, obwohl in der Branche üblicherweise nur jährliche Preisänderungen vorgenommen werden. Nachdem die Energiepreise wieder sanken, wurden Preislisten wieder im ursprünglichen Rhythmus veröffentlicht.
Marktmacht statt Wettbewerb
Um das „Rocket and Feathers“-Phänomen zu erklären, bedarf es neben der variierenden Aufmerksamkeit der Nachfrageseite noch einer weiteren Zutat: Marktmacht auf der Angebotsseite.[1] Schließlich könnte ansonsten bei fallenden Produktionskosten ein Konkurrent die Aufmerksamkeit der Nachfrage durch eine Preissenkung auf sich ziehen und somit Marktanteile gewinnen. Schnell würde ein Preiskampf entstehen, der die Margen auffrisst.
In der Realität funktioniert Wettbewerb allerdings selten so reibungslos. Stattdessen haben Unternehmen häufig zumindest lokale Marktmacht. Ein typischer Grund hierfür sind Suchkosten nach einem passenden Anbieter.
Ein anschauliches Beispiel ist die Suche nach dem günstigsten Benzinpreis. Wenn keine Preisinformationen verfügbar sind, müssen Kund:innen physisch mehrere Tankstellen anfahren, was mit Aufwand und Kosten verbunden ist. Daher wird häufig beim ersten Anbieter getankt, sofern der Preis akzeptabel erscheint. Dieses Phänomen ist in der ökonomischen Literatur als Diamond-Paradoxon bekannt.
Auch ein oligopolistisches Marktumfeld kann Marktmacht begünstigen. In solchen Strukturen ist die Nachfrage oft wenig elastisch, da der Wettbewerbsdruck gering ist. Eintrittsbarrieren und hohe Kapitalkosten verhindern den Zugang neuer Anbieter. Unternehmen können daher ihre Preise über den Grenzkosten halten, ohne unmittelbare Konsequenzen befürchten zu müssen.
Im Zementsektor ist lokale Marktmacht besonders ausgeprägt. Der Markt ist stark regional organisiert, was vor allem auf die physikalischen Eigenschaften des Produkts zurückzuführen ist: Zement hat ein hohes Gewicht bei gleichzeitig niedrigem Warenwert pro Tonne. Transportkosten machen daher einen erheblichen Anteil der Gesamtkosten aus. Bei einem durchschnittlichen Warenwert von rund 64 Euro pro Tonne fallen etwa 10 Euro Transportkosten an. Der deutsche Zementverband weist darauf hin, dass Transporte über eine Distanz von mehr als 300 Kilometern wirtschaftlich kaum sinnvoll sind.
Diese Kostenstruktur führt zu regionalen Marktsegmenten mit oligopolartigen Strukturen und entsprechend heterogenen Preisniveaus. Die hohen Investitionskosten für den Bau neuer Zementwerke stellen zudem eine klare Eintrittsbarriere dar.
Eine weitere potenzielle Ursache für Marktmacht können explizite oder implizite Preiskoordinierungen sein. Dieser Aspekt wird in der ökonomischen Literatur regelmäßig diskutiert, wenngleich empirische Belege begrenzt sind. Weber et al. (2025) zeigen, dass breite Inputkostenschocks als implizites Koordinationssignal wirken: Unternehmen gehen davon aus, dass auch ihre Wettbewerber die Preise anheben werden, und können daher ihre Mark-ups, also den prozentualen Aufschlag auf die Kosten zur Bestimmung des Verkaufspreises, stabil halten. Bei höheren Kosten und Preisen steigt dadurch der Gewinn je Einheit und, wenn Löhne verzögert nachziehen, auch die Profitquote.
Auch im Zementsektor wurde auf die Gefahr marktmachtsteigernder Verhaltenskoordinierung hingewiesen. Das Bundeskartellamt veröffentlichte im Jahr 2017 einen Bericht, der die potenziellen Risiken solcher Koordinierung hervorhebt. Die oligopolartige Marktstruktur bietet grundsätzlich günstige Voraussetzungen für abgestimmtes Verhalten. Zusätzlich begründet sie ihre Untersuchung darin, dass es auch in der Vergangenheit Kartelle im Zementsektor gegeben hat.
Zementunternehmen mit Beinfreiheit
Das „Rocket and Feathers“-Phänomen, bei dem Preise bei steigenden Kosten rasch anziehen, aber bei sinkenden Kosten nur langsam oder gar nicht zurückgehen, ist in vielen Sektoren zu beobachten. Für einen Überblick lohnt sich ein Blick in unseren Supply Side Monitor, der monatlich unter anderem Preis- und Produktionsentwicklungen abbildet.
Die Ursachen für eine solche Preisentwicklung sind sektorspezifisch und können sich gegenseitig verstärken. Im Zementmarkt deutet vieles darauf hin, dass die stark regional segmentierte Marktstruktur und die geringe Preiselastizität der Nachfrage es Unternehmen ermöglichen, Preise über den Grenzkosten zu halten. Ob asymmetrische Anpassungskosten bei der Kapazitätsausweitung eine wesentliche Rolle spielen, bleibt offen, da die gemeldeten Produktionshemmnisse ein uneinheitliches Bild zeigen.
Eine differenzierte Analyse der Preisbildungsmechanismen bleibt daher auch in Zukunft zentral, um Preisentwicklungen in diesem und ähnlichen Märkten besser zu verstehen.
Unsere Leseempfehlungen:
- Wer wissen will, was Bierpreise über die deutsche Wirtschaft verraten, sollte in die aktuelle Folge des Podcasts „Die Geldfrage“ (Spotify, Apple Podcast) reinhören.
- Das Yale Budget Lab zeigt kompakt die bisherigen Auswirkungen der US-Zölle auf den US-Haushalt, Preise, Handel und Arbeitsmarkt.
- Ein Jahr nach dem Draghi-Report analysiert FT-Kolumnist Martin Sandu den Weg zu einem einheitlichen europäischen Unternehmensrecht – Knackpunkt für einen zukünftigen Einheitsmarkt.
Medienbericht 25.09.2025
Medienerwähnungen und Auftritte
- Rückblick
- Am 14.09.2025 war Philippa Sigl Glöckner mit Heidi Reichinnek und Michael Bröcker zu Gast bei Caren Miosga in ihrem Talkformat in der ARD.
- Am 15.09.2025 veröffentlichten die FAZ, Berliner Morgenpost und die Rheinische Post TV-Kritiken zum Auftritt mit Philippa Sigl-Glöckner bei Caren Miosga.
- Am 17.09.2025 veröffentlichte das Wirtschaftsmagazin Surplus einen Gastbeitrag von Levi Henze zum Lebensqualitätsminimum.
- Am 21.09.2025 war Florian Schuster-Johnson im BTO Podcast zu Gast und sprach über den schrumpfenden fiskalischen Spielraum im Bundeshaushalt.
- Am 21.09.2025 berichtete das Handelsblatt in einen Artikel über den Fiscal-Space-Indikator und den Berechnungen des Dezernat Zukunft.
- Am 23.09.2025 war Florian Schuster-Johnson zu Gast im WDR 5 Podcast Politikum und sprach über den aktuellen Haushalt und den sinkenden Spielraum für Regierungshandeln.
- Am 23.09.2025 war Florian Schuster-Johnson bei NTV im Interview zu Gast und hat über den Bundeshaushalt 2026 gesprochen und ob dieser Wachstumsimpulse setzt.
- Am 23.09.2025 hat die SZ unsere Berechnungen zum Haushalt und unseren Fiscal-Space-Indikator
- Am 25.09.2025 hat Bloomberg in einem Artikel Niklas Illenseer zur Finanzierung des Industriestrompreises aus dem KTF zitiert.
- Ausblick
- Am 01.10.25 findet das nächste Ideas of Energy Event statt. Dieses Mal geht es um die Rolle der Wissenschaft in der Energiewende. Als Expertin ist Doris Segets, Professorin für Verfahrenstechnik elektrochemischer Funktionsmaterialien an der Universität Duisburg-Essen, zu Gast. Hier geht es zur Anmeldung.
Fußnoten
[1] Peltzman (2000) findet keine verstärkt asymmetrische Preissetzung in Sektoren mit höherer Konzentration (gemessen am Herfindahl-Hirschman-Index), wobei jeweils der Gesamtmarkt betrachtet wird. Dies steht nicht im Widerspruch zu unseren Aussagen, da wir Marktmacht als die Fähigkeit definieren, Preise dauerhaft über den marginalen Kosten zu halten. Diese Marktmacht ergibt sich in unserem Fall vor allem aus der Regionalität der Märkte, in denen nur wenige Wettbewerber aktiv sind.
Der Geldbrief ist unser Newsletter zu aktuellen Fragen der Wirtschafts-, Fiskal- und Geldpolitik. Über Feedback und Anregungen freuen wir uns. Zusendung an aurora.li[at]dezernatzukunft.org
Hat dir der Artikel gefallen?
Teile unsere Inhalte



