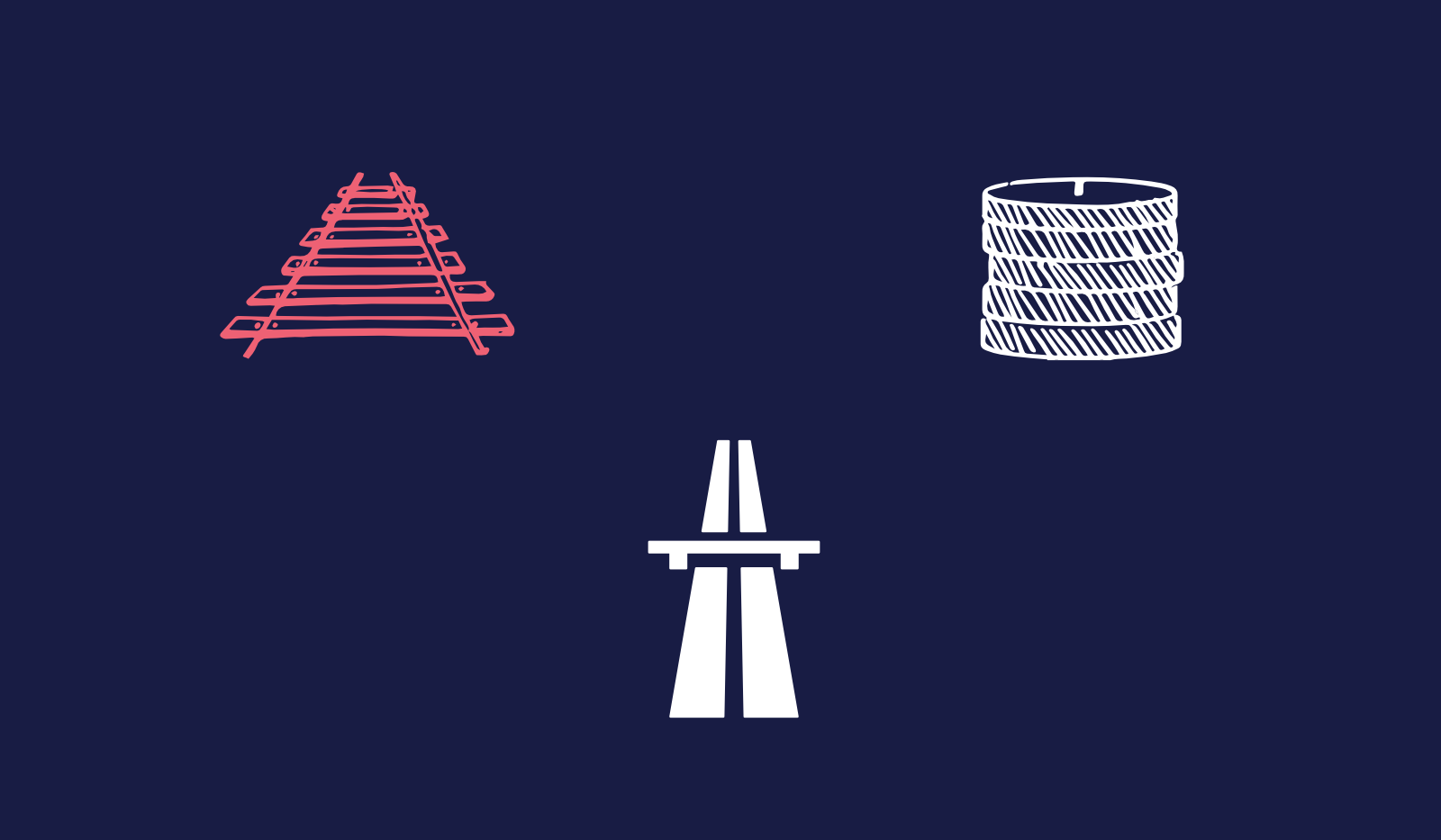
Haushalt 2025 – Auf halber Strecke zu tragfähiger Finanzierung von Schiene und Straße
Niklas Illenseer, Dr. Vera Huwe
Der Haushaltsentwurf 2025 setzt Impulse, um Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur zu stärken. Dabei rückt der Erhalt in den Fokus. Geld für die Brückensanierung kommt aus dem Sondervermögen, wobei ein Großteil aus dem Kernhaushalt umgeschichtet wurde. Auch für den Erhalt der Schiene werden durch das Sondervermögen reguläre Haushaltspositionen finanziert. Neben der Höhe ist auch die Form der Mittel entscheidend. Ein Großteil der Schieneninvestitionen läuft über Eigenkapital, was zwar schuldenbremsenneutral ist, jedoch zu höheren Trassenpreisen führen kann. Das Sondervermögen ist kurzfristig hilfreich, stellt jedoch keine nachhaltige Finanzierung von Daueraufgaben dar.
Der Haushaltsentwurf 2025 sieht steigende Investitionen für alle Verkehrsinfrastrukturen vor. Für die Schiene gibt es rund 3,7 Milliarden Euro mehr im Vergleich zum alten Regierungsentwurf. Das ist eine gute Nachricht. Das meiste Geld soll in den Erhalt bestehender Infrastruktur wie Schienen und Straßenbrücken fließen, also dafür sorgen, dass kaputte Strecken und veraltete Technik erneuert werden. Das ist bitter nötig.
Aber: Einige dieser Daueraufgaben sind ins Sondervermögen gewandert – das ist kurzfristig gut, aber trägt nicht langfristig. Außerdem geht ein Großteil der Gelder für die Schiene auf eine Eigenkapitalerhöhung zurück, die die Trassenpreise nach oben treibt.
Vernebelte Brückensanierung
Das Geld für die Straße kommt nun aus drei verschiedenen Quellen: Das meiste Geld steuert weiterhin der Verkehrsetat bei, ein kleiner Teil der Verteidigungsetat und das Sondervermögen sorgt dafür, dass Brücken endlich saniert werden.
Dass es nun explizit Geld für den Erhalt von Brücken gibt, ist gut, wenn auch immer noch weniger als nötig wäre. Auffällig ist, dass Brücken bislang unter den Investitionen der Autobahn GmbH im Verkehrsetat mitveranschlagt waren. Und genau diese Investitionen sollen dieses Jahr im Vergleich zum alten Regierungsentwurf sinken – um 2,5 Milliarden Euro (Abbildung 1). Davon entfallen 1,8 Milliarden Euro Kürzung auf Brücken und Tunnel. So viel zusätzliches Geld für Brücken ist es also nicht.
Abbildung 1
Wie viele Mittel können kurzfristig verbaut werden? Die Baukapazitäten sind begrenzt. Damit die Brücken wieder in Schuss kommen und bleiben, ist es wichtig, dass die Regierung die Instandhaltung als Daueraufgabe begreift und entsprechend finanziert.
Da die 0,9 Milliarden Euro aus dem Verteidigungsetat künftig für Erhaltung und Erweiterung der Bundesfernstraßen verfügbar gemacht werden, könnten die Mittel für den Aus- und Neubau von Fernstraßen insgesamt steigen. Dabei sind Bedarfe für den dringend notwendigen Substanzerhalt weiterhin ungedeckt und müssen wichtiger genommen werden.
Lkw-Maut im Haushaltsdienst: Fiskalisch vorteilhaft, aber zulasten der Schiene
Eine weitere Änderung betrifft die Lkw-Mauteinnahmen. Bisher wurde ein Teil der Einnahmen auch für die Schiene verwendet: 2,4 Milliarden Euro zum Erhalt der Schiene waren es im alten Regierungsentwurf. Das fällt jetzt weg (Abbildung 2). Klickt man in der interaktiven Grafik auf die unterschiedlichen Jahreszahlen, wird diese Entwicklung deutlich.
Künftig sollen Mauteinnahmen fast ausschließlich der Straße zugutekommen und von der Autobahn GmbH eingenommen werden. Das hilft dem Haushalt, denn Einnahmen ermöglichen es, die Autobahn GmbH als Marktakteur einzustufen – und damit nicht dem Staatssektor zuzuordnen. Damit würden ihre Darlehen nicht auf die europäische Schuldenregeln angerechnet. Während die Deutsche Bahn bereits als solcher Marktakteur gilt, ist das bei der Autobahn GmbH bislang nicht der Fall. Eigene Einnahmen helfen dem Bund auch, Darlehen an die Autobahn GmbH zu vergeben, die dann mit den Einnahmen zurückgezahlt werden können. Notwendig sind sie dafür aber nicht.[1]
Abbildung 2
Dieser fiskalische Kniff wird zum Beispiel auch in Österreich genutzt. Da die Autobahn GmbH für die Klassifikation als „Marktproduzent“ lediglich 50 Prozent der Kosten durch eigene Einnahmen decken muss, müssten nicht auch die gesamten Lkw-Mauteinnahmen an die Autobahn GmbH fließen. Deshalb bleibt die Debatte, wie begrenzte Mittel zwischen Straße und Schiene priorisiert werden sollten, relevant.
Steigende Schieneninvestitionen – mit Fokus auf Bestand
Für die Bundesschienenwege sind insgesamt Investitionen in Höhe von 22 Milliarden Euro vorgesehen, 3,7 Milliarden Euro mehr als im alten Regierungsentwurf. Das bedeutet mehr Mittel etwa in der Größenordnung der von uns geschätzten Bedarfe für das Jahr 2025.
Wie die Straße wird auch die Schiene künftig aus drei Quellen finanziert: Der Aus- und Neubau erhält Geld aus dem Verkehrs- und dem Verteidigungsetat, insgesamt jedoch weniger als zuvor geplant. Eine Eigenkapitalerhöhung der DB (und kleinere Posten) trägt wie gehabt der Verkehrsetat. Da das Geld für den Erhalt der Schiene nach dem Wegfall der Lkw-Maut aus dem Sondervermögen kommt, werden also Mittel hin- und hergeschoben und unterm Strich wird weniger investiert als es den Anschein macht: Weniger als die Hälfte des frischen Geldes aus dem Sondervermögen ist tatsächlich zusätzlich.
Abbildung 3
Die gute Nachricht: Der Bestandserhalt wird gestärkt, der Fokus scheint sich hin zur Ertüchtigung des Netzes zu verschieben. Im Vergleich zum Haushaltsentwurf der alten Regierung wachsen die Mittel für Erhalt von 2,4 Milliarden deutlich auf 7,6 Milliarden Euro. Aber Vorsicht: Die Ampel hatte hier radikal zusammengestrichen; im Vorjahr 2024 lagen sie noch bei 7,5 Milliarden Euro (Abbildung 3). Das vermeintliche Plus ist also ein Zurück zum vorherigen Niveau – kein Sprung, sondern eine Verstetigung. Gleichzeitig sinken die Mittel für Neu- und Ausbau. Die Priorisierung des Bestands ist also relativ: Sie entsteht nicht durch einen Aufwuchs der Mittel für den Erhalt, sondern auch durch Kürzungen beim Neu- und Ausbau.
Die Form entscheidet: Eigenkapital mit Nebenwirkung
Ein Großteil der Investitionen in die Schiene läuft über Eigenkapitalerhöhungen, erstmals 2024 (Abbildung 4). Heißt, der Bund gibt der Deutschen Bahn Geld, das sie als eigenes Kapital ausweist. Der Vorteil aus Haushaltssicht: Stockt der Bund das Eigenkapital der DB auf, ist dieser Vorgang als finanzielle Transaktion schuldenbremsenneutral. Um von einem Zuschuss unterscheidbar zu sein, muss die DB darauf eine Rendite erzielen.
Abbildung 4
Der Haken: Das Eigenkapital muss in der Bilanz aktiviert werden und schlägt, wie wir hier ausführlicher erklären, direkt auf die ohnehin hohen Trassenpreise durch.[2] Ein Teil des Eigenkapitals wird voraussichtlich in Aus- und Neubau investiert. Unterstellen wir einen Anteil von etwa 20 Prozent, entspräche das 1,7 Milliarden Euro. Die Gesamtmittel für Aus- und Neubau würden in diesem Szenario leicht steigen – allerdings auf Kosten erhöhter Trassenpreise. Das wiederum macht es für Güter und Personen teurer, auf die Schiene zu wechseln und löst Folgekosten beim Bund aus.
Auch wenn die Eigenkapitalzufuhr gegenüber dem alten Haushaltsentwurf etwas zurückgenommen wird (nun 8,5 statt 10,4 Milliarden Euro): Sie bleibt strukturell falsch angelegt. Spätestens ab 2026 sollten diese Mittel durch Baukostenzuschüsse oder gut konzipierte Darlehen ersetzt werden, da hier keine Rendite gezahlt werden muss und sie sich damit nicht auf die Trassenpreise auswirken.
Zukunft geht nicht auf Abruf
Ein weiteres Problem: Die Planungssicherheit fehlt. Das macht es für Großprojekte wie den Ausbau des Schienennetzes extrem schwer, denn Planen und Bauen dauert Jahre. Es braucht Vorlauf und Verlässlichkeit, auch damit Unternehmen sich entscheiden, in Schienenprojekte zu investieren.
Was es braucht, ist ein verlässlicher, langfristiger und verbindlicher Finanzierungsrahmen, damit vernünftig geplant und Baukapazitäten ausgeweitet werden können. Das geht über ausreichende Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt und die angekündigte Finanzierungsvereinbarung LV InfraGO. Ansonsten gehen knappe Bauressourcen weiter in kurzfristige, oft teurere Projekte und damit in die Preise, wie bei der Riedbahn.
Noch besser für die langfristige Finanzierungssicherheit wäre ein eigener überjähriger Schienenfonds, wie es ihn in der Schweiz schon gibt – dauerhaft, außerbudgetär, verlässlich.
Fazit: Richtige Richtung, halbe Strecke
Der Haushalt 2025 setzt Impulse – vor allem mehr Geld für die Schiene und den Erhalt der bestehenden Infrastruktur. Doch es gibt auch Finanzzauberei: Die Verschiebung der Mautmittel reduziert die Zusätzlichkeit der Investitionen aus dem Sondervermögen und die Eigenkapitalzufuhr der DB verursacht Folgekosten. Die für die Verkehrsinfrastruktur so wichtige Planungssicherheit bleibt auf der Strecke.
Für einige drängende Bedarfe schafft das Sondervermögen Abhilfe. Eine kurzfristige Lösung über das Sondervermögen ist besser als keine – vor allem, um dem drängenden Sanierungsstau zu begegnen. Doch der Infrastrukturerhalt ist eine Daueraufgabe. Und dauerhafte Aufgaben erfordern eine dauerhaft tragfähige Finanzierung.
Unsere Leseempfehlungen:
- Transport and Environment hat sich ebenfalls angesehen, wie viel Verkehrsinfrastruktur im neuen Haushaltsentwurf steckt und kritisiert eine fehlende Priorisierung von Erhalt vor dem Aus- und Neubau von Straßeninfrastruktur.
- Die FAZ berichtete letzte Woche über drohende Ticketpreissteigerungen von mehr als 10 Prozent bei der Bahn. Das Problem: Die Trassenpreise. Was es damit auf sich hat, haben wir hier bereits ausführlicher erklärt.
- New York City wählt im November einen neuen Bürgermeister. Bei den Vorwahlen der Demokraten letzten Monat gewann der junge Abgeordnete Zohran Mamdani der Demokratischen Sozialisten. Mamdani war mit Forderungen nach bezahlbarem Wohnraum, besserem öffentlichen Nahverkehr und Versorgung sowie Vermögensumverteilung angetreten. W. Mason analysiert hier präzise, wo genau die fiskalischen Stellschrauben und Hürden für die Umsetzung von Mamdani’s Forderungen liegen.
Medienbericht 10.07.2025
Medienerwähnungen und Auftritte
- Rückblick
- Am 20.06.25 erschien beim Online-Magazin der Arbeitsstelle Eigenständige Jugendpolitik ein Interview mit Saskia Gottschalk zu zukunftsgerechter Finanzpolitik.
- Am 24.06.25 schrieb die GEW über den von uns errechneten Investitionsstau.
- Am 24.06.25 veröffentlichte der Spiegel einen interaktiven Rechner mit den Zahlen von Dezernat Zukunft zum Investitionsbedarf.
- Am 25.06.25 hat Niklas Illenseer mit dem Tagesspiegel Background und klima.neutral (WDR) zum KTF gesprochen.
- Am 25.06.25 fand unser Büroevent mit Professor Julian Hinz statt. Wir haben über Zölle, instabile Lieferketten und geopolitische Spannungen diskutiert.
- Am 26.06.25 zitierte The Economist Florian Schuster-Johnson zum neuen Haushalt.
- Am 27.06.25 schrieb t-online über Saskia Gottschalks Growth Update #1 und zitierte Florian Schuster-Johnson zu den Rekordinvestitionen.
- Am 27.06.25 war Philippa Sigl-Glöckner beim WDR im Radio und sprach über Geld und Kultur im Rahmen der phil.Cologne.
- Am 27.06.25 berichtete die Süddeutsche Zeitung über Saskia Gottschalks Growth Update #1 und zitierte Dr. Florian Schuster-Johnson zu den Folgen des neuen Haushalts.
- Am 27.06.25 wurde Florian Schuster-Johnson zum Wachstum bei regionalHeute zitiert.
- Am 29.06.25 wurde Florian Schuster-Johnson in der moz zu den Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern zitiert.
- Am 02.07.25 berichtete das Handelsblatt über unseren Vorschlag, sich an den EU-Schuldenregeln statt der nationalen Schuldenregel zu orientieren.
- Am 03.07.25 wurden Philippa Sigl-Glöckner und Florian Schuster-Johnson zum schrumpfenden Handlungsspielraum des Haushalts bei Hasepost zitiert.
- Am 04.07.25 veröffentlichte Max Krahé mit Michael Müller den Artikel „The Limits of Limiting Democracy“ auf dem Verfassungsblog.
- Die Printausgabe des Spiegel berichtete am 04.07.25 über die schrumpfenden Handlungsspielräume und zitierte Philippa Sigl-Glöckner zu steigenden Zinszahlungen und Survival Subsidies.
- Am 06.07.25 zitierte das Handelsblatt Florian Schuster-Johnson zu nötigen Reformen im Bundeshaushalt.
- Am 08.07.25 schrieb das ZDFheute im Update am Morgen über unsere Studie zur Manövriermasse.
- Am 08.07.25 schrieb das Eurointelligence Professional über unsere Studie zu den schrumpfenden Handlungsspielräumen in ihrem Daily Morning Briefing.
- Am 08.07.25 interviewte ntv Florian Schuster-Johnson zum Papier über die verschwindende Manövriermasse.
- Am 08.07.25 wurde Philippa Sigl-Glöckner zum Sondervermögen im WDR 5 Morgenecho
- Am 08.07.25 schrieb die Süddeutsche Zeitung [Paywall] über unsere Daten aus dem 3 Prozent Papier zur Entwicklung der Zinskosten.
Fußnoten
[1] Darlehen an die Autobahn GmbH können als finanzielle Transaktion verbucht werden, wenn erwartet werden kann, dass sie zurückgezahlt werden. Generiert die Autobahn GmbH keine oder nicht ausreichende eigene Einnahmen, kann der Bund die Rückzahlung auch durch Bundeszuschüsse finanzieren. Diese müssen im Finanzplan eingeplant werden, damit es nicht zu verdeckter Verschuldung des Bundes kommt, siehe Schuster-Johnson & Sigl-Glöckner (2024).
[2] Wie hoch der Effekt auf die Trassenpreise am Ende genau sein wird, hängt auch davon ab, ob ein Kompensationsmechanismus gefunden wird und inwiefern der Bund den Instandhaltungszuschuss einsetzt. Seit der Novelle des Bundesschienenwegeausbaugesetzes im letzten Jahr hat der Bund damit ein Instrument in der Hand, um den Trassenpreis zu steuern – dieses wird jedoch separat vom Haushalt geregelt.
Der Geldbrief ist unser Newsletter zu aktuellen Fragen der Wirtschafts-, Fiskal- und Geldpolitik. Über Feedback und Anregungen freuen wir uns. Zusendung an niklas.illenseer[at]dezernatzukunft.org
Hat dir der Artikel gefallen?
Teile unsere Inhalte



